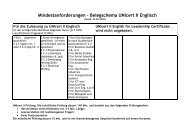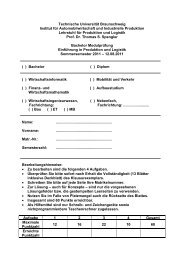download - Technische Universität Braunschweig
download - Technische Universität Braunschweig
download - Technische Universität Braunschweig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung 1<br />
1 Einleitung<br />
Die privaten Haushalte und Kleinverbraucher haben einen Anteil von 44% am Endenergieverbrauch<br />
in der Bundesrepublik Deutschland. Davon werden 75% für die Beheizung von<br />
Gebäuden aufgewendet. Da die Wärme auf einem niedrigen Temperaturniveau von 40 - 90 °C<br />
benötigt wird, bietet sich hier ein breites Einsatzfeld für die thermische Solarenergienutzung.<br />
Für die Brauchwassererwärmung werden Solaranlagen bereits weit verbreitet eingesetzt, der<br />
Marktzuwachs in diesem Bereich liegt derzeit bei 30 - 35% pro Jahr. Mit den Solaranlagen<br />
zur Brauchwassererwärmung lassen sich im Wohnungsbau etwa 15% des Gesamtwärmebedarfes<br />
von Neubauten decken. Wird in Kombianlagen oder in Nahwärmenetzen die Solaranlage<br />
zusätzlich zur Unterstützung des Raumheizungssystems genutzt, so können 20 - 25% des<br />
Gesamtwärmebedarfes gedeckt werden. Wegen der zeitlichen Verschiebung von Solarstrahlungsangebot<br />
und maximalem Wärmebedarf können solare Deckungsanteile von 50%<br />
des Gesamtwärmebedarfes und darüber nur durch saisonale Wärmespeicherung erreicht<br />
werden. Diese wiederum ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur in Verbindung mit einer<br />
großen Solaranlage, d. h. innerhalb eines Nahwärmeversorgungssystems sinnvoll.<br />
Die Verwirklichung von solaren Nahwärmesystemen mit Langzeit-Wärmespeicherung wird<br />
am Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik der Universität Stuttgart seit 1989 verfolgt.<br />
Demonstrationsanlagen zur solaren Nahwärme mit Langzeit-Wärmespeicher werden seit<br />
1993 im Teilprogramm 3 des BMBF Förderprogramms “Solarthermie 2000“ gefördert. Seither<br />
wurden Vorprojekte zur Demonstration der Anlagentechnik großer Kollektorfelder<br />
(Projekte Ravensburg, Köngen, Neckarsulm I, Göttingen, Oederan) sowie der Bautechnik für<br />
Heißwasser-Wärmespeicher (Projekt Rottweil) realisiert. Im Oktober 1996 gingen die ersten<br />
Pilotanlagen zur solaren Nahwärmeversorgung mit Langzeit-Wärmespeicher (Heißwasser-<br />
Wärmespeicher) in Hamburg und Friedrichshafen in Betrieb. Die Auswertungen der Meßdaten<br />
der ersten Betriebsjahre zeigen, daß die prognostizierten Erträge erreicht werden können.<br />
Im Bau und Betrieb dieser beiden Anlagen wurden und werden wichtige Erfahrungen gesammelt,<br />
die in der Realisierung weiterer Projekte umgesetzt werden sollen. Die ersten Erfahrungen<br />
flossen bereits in den Bau der Anlage Neckarsulm II ein, wo erstmals ein Erdsonden-<br />
Wärmespeicher für den Temperaturbereich von 40 - 85 °C realisiert wurde. Die Anlagentechnik<br />
wurde hier modifiziert: erstmals kam ein Dreileiter-Wärmeverteil- und -sammelnetz<br />
zum Einsatz.<br />
Parallel zur Realisierung der Projekte wurden intensive Untersuchungen zu den Langzeit-<br />
Wärmespeicherkonzepten durchgeführt. Neben Materialfragen (Baustoffe, Auskleidungsmaterialien,<br />
Wärmedämmung) wurde die hydraulische und regelungstechnische Integration des<br />
Wärmespeichers in die Nahwärmeversorgung untersucht. Daneben wurde in der Folge der<br />
ersten solaren Großanlagen von einigen Herstellern die Kollektortechnik für Großanlagen<br />
weiterentwickelt. Auf der Basis des 1992 in Ravensburg installierten, vor Ort montierten Kollektordaches<br />
wurde das „Solar Roof“ entwickelt - eine vollständige Sparrendachkonstruktion<br />
mit einem flächendeckenden Kollektorfeld und einer internen hydraulischen Verschaltung.<br />
Insgesamt wurde mit den durchgeführten Pilotprojekten die Machbarkeit der solar unterstützten<br />
Nahwärmeversorgung eindrucksvoll demonstriert. Insbesondere bei den Kollektoren<br />
haben sich die Kostenprognosen für solare Großanlagen bestätigt: das Kosten/Nutzen-Verhältnis<br />
von solaren Großanlagen ist um den Faktor zwei (Anlagen mit saisonalem Wärmespeicher)<br />
bis vier (Anlagen ohne saisonalen Wärmespeicher) günstiger als bei Kleinanlagen<br />
zur Brauchwassererwärmung.