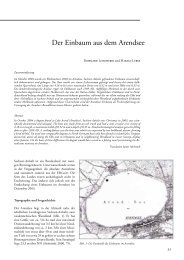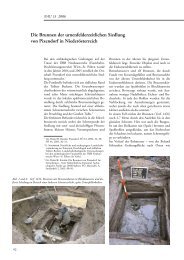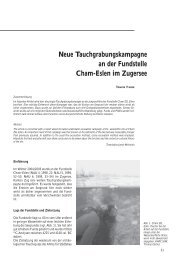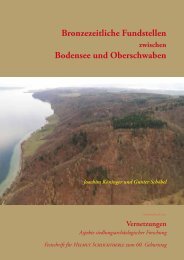Documents - Janus Verlag
Documents - Janus Verlag
Documents - Janus Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
NAU 14 2008Abb. 6: Elbe. ZahlenmäßigeVerteilungder Fundstellen aufdie unterschiedlichenZeitperioden (ohneundatierte Fundstellen).64bei der Dynamik der entsprechenden Vorgängekaum kontrollierbar sein. Diejenigen Flussabschnitte,in denen der Fluss potentiell alte Uferwällebzw. Marschgebiete schneidet, verdienendaher besondere Aufmerksamkeit. Auswirkungenauf Bereiche, die heute außerhalb derDeiche liegen sind hingegen als vergleichsweisegering einzuschätzen.Das Untersuchungsgebiet für die nachfolgendearchäologische Untersuchung wurde infolgedessenim Bereich der Unterweser auf die außerdeichsgelegenen Flussabschnitte eingegrenzt.Im Bereich der Außenweser wurde, unter Berücksichtigungörtlicher Gegebenheiten, ein Bereichvon 2,5 km rechts und links der Fahrrinnesowie die als Klappstellen ausgewiesenen Arealeangenommen. Die Verklappungen sind zwarin Bezug auf die Gefährdung von Denkmalenin diesen Bereichen unbedenklich, die entsprechendenFlächen in Zukunft wegen ihrer Bedeckungmit Baggergut archäologisch aber nichtmehr zugänglich. Auf dieses „Engere Untersuchungsgebiet“konnten sich dann alle nachfolgendenUntersuchungen – Kartierung vonFunden, Geländebegehungen, hydrographischeUntersuchungen – konzentrieren (vgl. Abb. 2).Archäologische Grundlagen der denkmalpflegerischenBewertung am Beispiel derElbeAls Grundlage der denkmalpflegerischen Bewertungdes Untersuchungsraums wurden systematischeLiteratur-, Museums- und Aktenrecherchendurchgeführt. Diese Arbeiten warenR. Blankenfeldt, T. Ibsen und N. Lau übertragen.Die aus den entsprechenden Untersuchungengewonnenen Daten konnten anschließendin ein Geographisches Informationssystem(GIS) eingearbeitet und mit den relevanten naturräumlichenGegebenheiten sowie mit denResultaten der Arbeiten im Gelände abgeglichenwerden. Geographische Grundlage undUntersuchungsgebiet bildete, entsprechend denArbeiten an der Weser, der Flusslauf mit denangrenzenden, außerdeichs gelegenen Arealen,wobei die archäologischen Verhältnisse auf denangrenzenden Marsch– und Geestflächen stellenweisemitberücksichtigt wurden.Als Basis für die Literaturrecherchen dienten dieLandesaufnahmen der Kreise Steinburg (Kersten1939) und Pinneberg (Ahrens 1966), dieLandesaufnahme der Stadt Hamburg (Schindler1960), sowie weitere, jüngere Fachpublikationen,in denen auch die niedersächsischeElbseite mit den Kreisen Cuxhaven und Stadeberücksichtigt sind. Grundlage für die Fundstellenkartierungstellten im Kern die Fundkarteiender im Untersuchungsgebiet zuständigenDenkmalbehörden dar. Ergänzt werdenkonnten die-se Akten um die Fundarchive derStadt- und Kreisarchäologie Stade, des Helmsmuseums/HamburgerMuseum für Archäologieund die Geschichte Harburgs sowie des Museumsfür Hamburgische Geschichte. Für die Untersuchungder Unterwasserhindernisse und dieKartierungen der Schiffswracks lieferte in ersterLinie die so genannte Wrackkartei des Bundesamtesfür Seeschifffahrt und Hydrographie inHamburg (BSH) die Basisdaten.Die Elbe mitsamt ihren Niederungsgebietenstellte für den Menschen zu allen Zeiten einenattraktiven Anziehungspunkt dar. Nicht nurdie Nutzungsgeschichte des Flusses, sondernauch die Erhaltungschancen für archäologischeQuellen sind allerdings stark mit der geologischenund paläohydrologischen Entwicklungdes Elbetales verbunden. Meeresspiegelanstieg,fluviatile Erosions- und Akkumulationsvorgänge,klimatische Veränderungen und verschiedeneStadien der Marschenbildung gestaltetenden Elbgrund immer wieder um. Entsprechendkomplex sind die Bedingungen für eine archäologischeBeurteilung.Generell reicht die zeitliche Spanne der heutebekannten Funde und Fundstellen vom Paläolithikumbis in die jüngste Neuzeit.Die ältesten archäologischen Nachweise stammenaus dem Elbufer bei Wittenbergen (Rust1949, 16; ders. 1956, 30–32;Taf. 31–38; Schindler1960, 11), sie werden zumeist in einen Zeitraumum 250000 Jahre vor heute datiert. Weiterearchäologische Belege liegen vom Ende derletzten Eiszeit vor, als die Elb-Niederterrassepotenziell begehbar war (Ahrens 1966, 62) undvon Rentierjägergruppen genutzt wurde (Tromnau1971, 69; ders. 1973, 72 f.). Wie Funde zeigen,waren auch während des Frühneolithikums