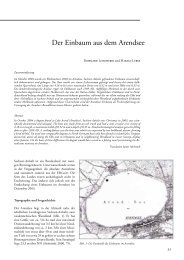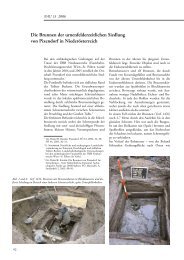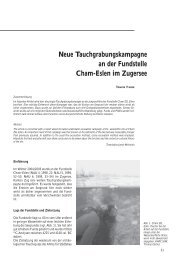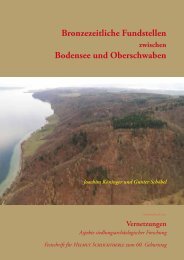Documents - Janus Verlag
Documents - Janus Verlag
Documents - Janus Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
NAU 14 200898lich auf den Tafelteil zurückgreifen), wird hiergrößtmögliche Anschaulichkeit erreicht. Fürden Rezensenten war es interessant, wie sichmultimodale (= mehrgipflige) Häufigkeitsverteilungenin mehrere überlappende Gauß‘scheNormalverteilungen aufspalten lassen, wie diesbeim Zinngehalt der Bronzen der Fall ist (S.120, Abb. 122). Zinnreiche Bronzen erweisensich im Vergleich zu zinnärmeren bezeichnenderweiseals die älteren. Da derart ausführlicheMetallanalysen an bronzezeitlichem Fundgutanderwärts noch weitgehend ausstehen, werdendie hier vorgestellten Ergebnisse für zukünftigeBearbeiter weiterer Siedlungen von hohem Nutzensein.Jeanne Bonzon vom Mineralogischen Institutder Universität Freiburg a. d. Saane, Schweiz,steuerte petrographische Dünnschliffuntersuchungenan den meist aus gebranntem Ton (ineinem Falle möglicherweise aus Sandstein) gefertigtenLanzenspitzen-Gussformen der Kampagnevon 1952–54 bei. Die der ausführlichenBeschreibung der Schliffbilder folgenden Ergebnissesind insofern wenig überraschend, alsdie Zusammensetzung von Ton und Magerungkaum von derjenigen der an späterer Stelle imBuch besprochenen Tongefäße abweicht. Deram Bernischen Historischen Museum tätigeMarkus Binggeli kümmerte sich um einen imarchäologischen Experiment nachvollzogenenLanzenspitzen-Nachguss mit Hilfe von Holzmodellen.Dem Fachmann bietet dies kaum Neues;der interessierte Laie hingegen wird seinen gutillustrierten Kurzbeitrag sicherlich mit Genussund Gewinn lesen. Immerhin wird deutlich,dass ein erfolgreicher Guss mit ca. 4 Stunden,gerechnet vom Anfertigen der Form bis hin zumfertigen Bronzeobjekt (die Trocknungszeit desTones ist nicht eingerechnet), nicht übermäßigzeitaufwändig ist.Das mit mehr als 100 Textseiten umfangreichsteKapitel des Werkes stammt zum größten Teilaus der Feder von Irmgard Bauer vom KantonalenMuseum für Urgeschichte Zug und BeatriceRuckstuhl/Schaffhausen. Es behandelt dieim Zuger Museumsdepot überreichlich magaziniertenTongefäßfragmente (fast 20000 Scherbenim Gewicht von 660 kg) der Grabungenvon Michael Speck. Dadurch versteht es sichvon selbst, dass die Keramik, im Gegensatz zuden vollständig im Tafelteil abgebildeten Bronzen,nur in repräsentativer Auswahl vorgelegtwerden konnte. Der einleitende Abschnitt istrein deskriptiver Natur und informiert überFormspektrum, Verzierungskanon und Magerungsartspätbronzezeitlicher Ware. Kurzbeschreibungund Definition der Grundformen(=Formgruppen), wie sie Abb. 152 liefert, würdensich bestens als Einführung in dieses Themaetwa für Studienanfänger der Faches Vorgeschichteeignen. Auch ungewöhnliche Fragestellungen,wie die nach der Sekundärnutzungvon Bodenscherben oder die so genannte „Fadenlochung“als keramische Eigenheit der spätbronzezeitlichenoberrheinisch-schweizerischenGruppe, werden abgehandelt. Gerade die Fadenlöcherin den Verzierungsrillen (in ihnenwurden Getreidehalme fixiert, die eine farblicheHeraushebung des Verzierungsmotivs auf demGefäßkörper erzielen sollten) geben zu weiterenÜberlegungen Anlass, handelt es sich hierbeidoch um Schwachstellen in der Gefäßwandung,die eine dauerhafte Aufbewahrung von Flüssigkeitenerschweren, wenn nicht gar verhindern.Krusten und Beläge als eingebrannte Reste vonGekochtem an den Innenwandungen der Töpfegestatten sogar Einblicke in den Speisezettel derSiedler im Sumpf.Nichts Neues bietet das folgende Kapitel zurChronologie und Keramikentwicklung. Hierwerden lediglich die im 2. Band der Reihe vonMathias Seifert anhand der Kampagnen von1952–54 herausgearbeiteten Grundzüge referiertund graphisch aufbereitet. In Ermangelungstratigraphischer Beobachtungen im Zugeder Grabungen der 1920er und 1930er Jahremussten sich die Bearbeiterinnen notgedrungenauf die von Josef Speck in den 1950er Jahrenbesser dokumentierten und von Mathias Seifertausgewerteten Befunde stützen und diese auf ihrMaterial übertragen. Insofern konnten sich dieAutorinnen hier kurz fassen.Ungewohnte, wenn auch nicht völlig neue Wegebeschreitet Sabine Bolliger Schreyer hingegenim mit „Handschriften“ überschriebenen Unterkapitel.Vor allem der so genannte „reiche Stil“,wie er sich auf den Gefäßen der älteren Siedlungsphasevor dem durch eine Brandkatastropheeingeleiteten Siedlungsunterbruch findet,fordert eine derartige Untersuchung geradezuheraus. Nach graphologischen Kriterien liessensich, unterstützt durch den Graphologen UrsImoberdorf, insgesamt 16 Handschriften ermitteln,die ebensovielen Töpfern bzw. Töpferinnenzugewiesen werden können. Weshalb sich IrmgardBauer an mehreren Stellen des Buches definitivauf Töpferinnen festlegt, ist nicht recht zueruieren. Es kommt der Wahrheit wohl näher,wenn, wie Sabine Bolliger Schreyer vermerkt(S. 212), nicht alle metrischen Unterschiede (inForm und Verzierung; Anm. des Rezensenten)chronologisch gedeutet werden, wie dies im All-