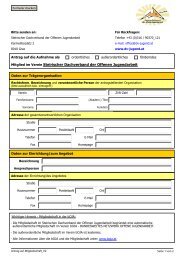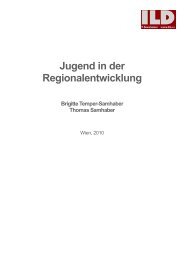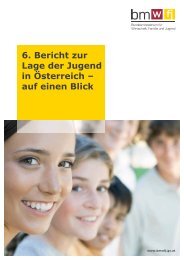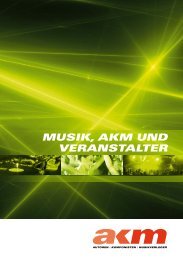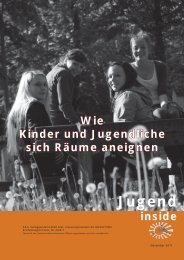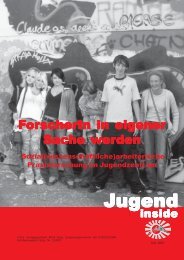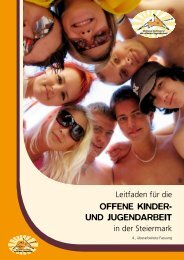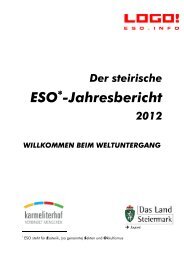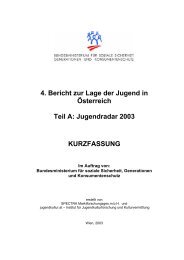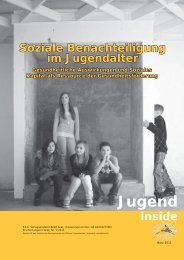Partizipation in der Steirischen Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Partizipation in der Steirischen Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Partizipation in der Steirischen Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>der</strong> Jugendverbandsarbeit – Mitverantwortungs- <strong>und</strong><br />
Selbstorganisationsansätze favorisiert;“ (Thole 2000,<br />
S. 239).<br />
Solche Anstrengungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis können m. E. am<br />
besten durch theoretische Gr<strong>und</strong>lagen gestärkt werden,<br />
die im Rahmen e<strong>in</strong>er Konzipierung von <strong>Jugendarbeit</strong><br />
als „Bildung“ entwickelt wurden. Deshalb sollen<br />
sie nun etwas ausführlicher dargestellt werden.<br />
V.3.2 Bildungsansätze <strong>und</strong><br />
<strong>Partizipation</strong>sorientierung<br />
In den Ansätzen von <strong>Jugendarbeit</strong> als subjektorientierte<br />
Bildung (beson<strong>der</strong>s bei B. Müller <strong>und</strong> A. Scherr)<br />
wird <strong>Partizipation</strong> im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Ermöglichung <strong>der</strong> Entwicklung<br />
von mitverantwortlicher Selbstbestimmung<br />
zur zentralen Aufgabe gemacht.<br />
Bereits 1993 hat Burkhard Müller kritisiert, dass die<br />
verschiedenen aktuellen Konzepte von <strong>Jugendarbeit</strong><br />
sich nicht mehr explizit auf die jugendarbeiterische<br />
Ermöglichung e<strong>in</strong>er „Selbst<strong>in</strong>itiation“ von K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen bezögen. Auch Müller unterscheidet<br />
„zwischen Erziehen als dem Vermitteln (manchmal<br />
auch E<strong>in</strong>bläuen) von gesellschaftlichen Werten<br />
<strong>und</strong> Bildung als dem Vorgang, durch den e<strong>in</strong> Individuum<br />
zu e<strong>in</strong>er eigenen Wertorientierung <strong>und</strong> Lebensform<br />
kommt...“ (Müller 1996, S. 89) Müller bestimmt<br />
den so verstandenen emanzipatorischen Bildungsansatz<br />
<strong>der</strong> <strong>Jugendarbeit</strong> als e<strong>in</strong>e Basis <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
Konzepte, wie Raumorientierung, Kulturarbeit,<br />
Beziehungsarbeit o<strong>der</strong> Sozialarbeit. Wie auch immer<br />
die konzeptionelle Orientierung sei, <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis<br />
ergäben sich jeweils viele Möglichkeiten, Themen <strong>der</strong><br />
Selbstbestimmung <strong>und</strong> Handlungsformen <strong>der</strong> Ermöglichung<br />
solchen Eigens<strong>in</strong>ns aufzugreifen. Solche Aussagen<br />
ließen sich auch übersetzen als: Ermöglichung<br />
von <strong>Partizipation</strong>serfahrungen gehört zu den Essentials<br />
von <strong>Jugendarbeit</strong>. Der für Eröffnung von partizipativen<br />
Möglichkeiten mitverantwortlicher Selbstbestimmung<br />
so zentrale Eigens<strong>in</strong>n wird nach Müller<br />
beson<strong>der</strong>s greifbar <strong>in</strong> Konflikten, <strong>in</strong> denen die Jugendlichen<br />
Interessen <strong>und</strong> Handlungsweisen zeigen, die<br />
nicht ohne Weiteres mit denen ihrer <strong>Jugendarbeit</strong>erInnen<br />
übere<strong>in</strong>stimmen. So können ihren Raum-<br />
aneignungsweisen o<strong>der</strong> die Stile ihrer kulturellen<br />
Selbstbehauptung ebenso wie die Geme<strong>in</strong>schaftsweisen<br />
<strong>in</strong> ihren cliquen <strong>und</strong> Szenen zu Konflikten führen,<br />
weil sie die Erwartung erwachsener Pädagogen enttäuschen.<br />
Diese Handlungsweisen <strong>und</strong> Interessen aufzugreifen<br />
<strong>und</strong> sie als e<strong>in</strong>en konstruktiven „Kampf um<br />
Anerkennung“ zu verstehen, würde Bildungspotenziale<br />
von <strong>Jugendarbeit</strong> eröffnen, wie<strong>der</strong> könnte man<br />
ergänzen: <strong>Partizipation</strong>spotentiale eröffnen. Müller<br />
vertritt also explizit e<strong>in</strong>en Konfliktansatz. Eigens<strong>in</strong>n<br />
<strong>und</strong> Selbstbestimmung werden da greifbar, wo Interessen<br />
<strong>und</strong> Handlungsweisen konflikthaft zusammenstoßen.<br />
Statt <strong>Partizipation</strong> künstlich zu <strong>in</strong>itiieren (o<strong>der</strong><br />
sie gar funktionalisierend didaktisch zu organisieren),<br />
braucht man nur dort anzusetzen, wo sich das Eigene<br />
schon entfaltet: <strong>in</strong> Konflikten.<br />
Auch Albert Scherr, <strong>der</strong> mit se<strong>in</strong>er „subjektorientierten<br />
<strong>Jugendarbeit</strong>“ (1997) die aktuell elaborierteste Theorie<br />
zur emanzipatorischen Bildung <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Jugendarbeit</strong><br />
vorgelegt hat, bezieht sich auf den Kampf um Anerkennung<br />
(Honneth 1992). Die Erfahrung des Individuums<br />
von sozialer Anerkennung ist e<strong>in</strong>e wesentliche<br />
Bed<strong>in</strong>gung <strong>der</strong> Möglichkeit, e<strong>in</strong>e persönliche Individualität,<br />
Selbstbewusstse<strong>in</strong> <strong>und</strong> Selbstbestimmung zu<br />
entwickeln. Das Bedürfnis nach Anerkennung enthält<br />
aber auch e<strong>in</strong>e gesellschaftliche Dimension: „Anerkennung<br />
ist e<strong>in</strong> Gegenbegriff zur herrschaftlichen Unterwerfung<br />
von Individuen unter ihnen fremde Zwecke,<br />
zu ihrer bloßen Benutzung <strong>und</strong> Instrumentalisierung,<br />
zur Verletzung ihrer Würde <strong>und</strong> Integrität. Die Utopie<br />
e<strong>in</strong>er Gesellschaft freier <strong>und</strong> gleicher Individuen, die<br />
Vorstellung nichtrepressiver Geme<strong>in</strong>schaften kann als<br />
e<strong>in</strong> Verhältnis <strong>der</strong> wechselseitigen Anerkennung als<br />
Subjekte konkretisiert werden.“ (Scherr 1997, S. 53)<br />
Mit dem Blick auf die Bedeutung <strong>der</strong> sozialen Anerkennung<br />
für die Personalisation wird deutlich, dass<br />
Scherrs Ziel e<strong>in</strong> mündiges Subjekt ist, das nicht als<br />
monadisch <strong>in</strong>dividuell gedacht wird, son<strong>der</strong>n das aus<br />
<strong>der</strong> Angewiesenheit auf Strukturen wechselseitiger<br />
Anerkennung aufbauend e<strong>in</strong>e selbstbewusste <strong>und</strong><br />
selbstbestimmte Lebenspraxis entwickelt. Die basale,<br />
von sozialer Anerkennung abhängige Selbstachtung<br />
wird ergänzt durch das Selbstbewusstse<strong>in</strong>, durch<br />
die reflexive Fähigkeit, Wissen über sich selber auch<br />
sprachlich fassen zu können. Aus diesem Wissen <strong>und</strong><br />
DVJ: <strong>Partizipation</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Steirischen</strong> <strong>Offenen</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendarbeit</strong>, Jänner 2009 - 56 -