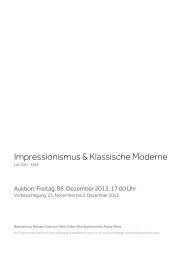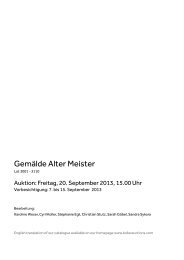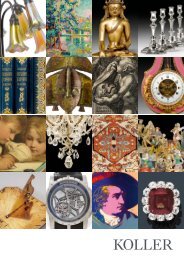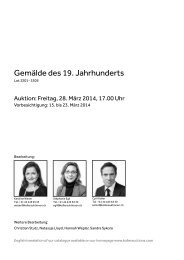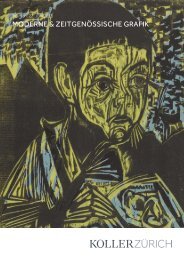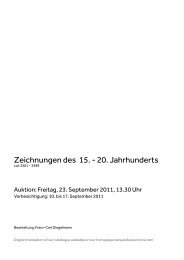Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen
Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen
Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
158<br />
MÖBEL, PENDULEN, BRONZEN, SPIEGEL, TAPISSERIEN UND DIVERSES<br />
1250*<br />
AMEUBLEMENT „A L’ANTIQUE“, spätes <strong>Louis</strong> <strong>XVI</strong>, wohl Russland,<br />
Ende 19. Jh.<br />
Bestehend aus 1 zweiplätzigen Canapé, 1 Paar Fauteuils und 1 Paar<br />
Stühlen. Rosenholz kanneliert, profiliert und ausserordentlich fein<br />
beschnitzt mit Henkelvase, Girlanden, Blumen, Blättern und Zierfries<br />
sowie teils vergoldet. Das Canapé und die Fauteuils mit feinen<br />
Wedgwood-Medaillons; Darstellungen aus der griechischen Mythologie<br />
mit Figurenstaffage. Hufförmiger Sitz auf wellig ausgeschnittener<br />
Zarge mit sich nach unten verjüngenden Beinen mit Nodus.<br />
Medaillonförmige Rückenlehne mit zentraler Henkelvase, das<br />
Canapé und die Fauteuils mit gepolsterten Armlehnen auf<br />
geschweiften -stützen. Hellblauer Seidenbezug mit feinen Blumen<br />
und Blättern. Canapé 136x60x45x99 cm, Fauteuils 62x55x45x99<br />
cm, Stuhl 52x46x45x96 cm.<br />
Provenienz: Aus einer englischen Privatsammlung.<br />
1250 (Detail) 1250 (Detail)<br />
Hochbedeutendes, als „Rarissima“ zu bezeichnendes Ameublement von perfekter<br />
Qualität und Eleganz, das die „Verspieltheit“ und Eigenständigkeit<br />
russischer Hofmöbel in exemplarischer Weise offenbart; es ist die meisterhafte<br />
Verbindung französischer, englischer und deutscher Entwürfe und Vorbilder.<br />
Die hochwertige Ausarbeitung lässt auf einen höfischen Spezialauftrag<br />
schliessen - die Sitzmöbel zeigen die „modische Eleganz“ der Epoche und dadurch<br />
einen bedeutenden Repräsentanz-Charakter.<br />
Ein modellogleiches Ameublement ist Bestand des deutschen Kunsthandels<br />
und wurde an der TEFAF 2008 in Maastricht angeboten.<br />
Mehrere dekorative und konstruktionstechnische Elemente lassen die<br />
Zuschreibung an Russland sinnvoll erscheinen und zeigen zugleich den<br />
Einfluss französischer und englischer Entwerfer auf Werke für den Zarenhof.<br />
Die Vorbilder dieser Möbel waren sowohl direkte Käufe des Zarenhofes in Paris<br />
oder London sowie solche von Aristokraten auf Reisen durch Westeuropa, als<br />
vor allem auch zeichnerische Vorlagen der berühmtesten Entwerfer der<br />
Epoche; die Kataloge von Delafosse, Neufforge, Percier et Fontaine, Chippendale,<br />
Sheraton, Hope, Grossmann, Scheich usw. erfreuten sich grösster Beliebtheit<br />
und fanden in der typisch „russischen“ Adaptation ihre kongeniale<br />
Weiterentwicklung. Diese Kataloge - mit Titeln wie „Receuil de décorations<br />
intérieures“, „Journal des Luxus und der Moden“, „Magazin für Freunde des<br />
guten Geschmacks“, „Magazzino di mobili et modelli di mobili di ogni genere“<br />
usw. richteten sich nicht ausschliesslich an Spezialisten, sondern an die potente<br />
Käuferschicht, welche ihrerseits Wünsche und Vorstellungen von „richesse<br />
d’effet“ den Ebenisten, Architekten und Entwerfern mitteilten. Dies ist deshalb<br />
von grosser Bedeutung, weil sich damit die schier endlos erscheinende<br />
Formenvielfalt russischer Hofmöbel erklären lässt wie auch die Tatsache, dass<br />
im ausgehenden 18. Jh. historisch verschiedene <strong>Stil</strong>e und Formensprachen in<br />
Russland zur gleichen Zeit gefertigt und miteinander kombiniert wurden.<br />
Einer der wesentlichsten Entwerfer und Architekten, die im ausgehenden 18.<br />
Jahrhundert. am russischen Hof tätig waren und entscheidende Impulse für<br />
die Formenvielfalt und Phantasie gaben, war der aus Schottland stammende<br />
C. Cameron (1740-1812). Von ihm sind beispielsweise die von einem „extrème<br />
audacieux“ geprägten Fauteuils „aux salamandres“, bei welchen vollplastische<br />
Salamander die Armlehnen entlang zu kriechen scheinen und so die<br />
meisterhafte Umsetzung des „goût exotique“ darstellen. Es sind vor allem<br />
exotische Einflüsse wie orientalische Dekors und Formensprachen, Tiere und<br />
klassizistisch-antike Symbole, welche die Möbel- und Einrichtungsgegenstände<br />
des Zarenhofes um 1800 charakterisieren.<br />
Der wohl wichtigste russische Entwerfer und Architekt ist A. Voronikhine<br />
(1760-1814), der in den ausgehenden Jahren des 18. Jahrhunderts für den<br />
Herzog Stroganoff das Dekor für dessen Palast fertigte, ehe er sich in St.<br />
Petersburg niederliess, um als Professor der Architektur-Akademie zahlreiche<br />
Projekte der Innenausstattung von Palästen zu übernehmen, insbesondere von<br />
Pavlowsk. 1801 zerstörte ein Grossbrand wesentliche Teile des Palastes, und A.<br />
Voronikhine erhielt den Auftrag der Neumöblierung und -einrichtung. Es sind<br />
vor allem die Sitzmöbel, welche die grosse Phantasie von Voronikhine belegen:<br />
bei Beinen, Armlehnen, -stützen und den für Russland typischen fächerartigen<br />
Rückenlehnen, feine Schnitzerei der Gestelle mit Tiermotiven (Adler, Löwen<br />
und Schwäne). Durch die Verbindung verschiedener dekorativer Elemente erhielten<br />
Voronikhines Entwürfe - wie auch unsere Folge - zeitlose Eleganz. Es<br />
sind genau diese Elemente, welche die herausragende Eigenständigkeit russischer<br />
Hofmöbel charakterisieren - ohne auf die Einflüsse von Frankreich (die<br />
stark Jacobsche Eleganz aus dem Klassizismus) und England (die leicht wirkenden<br />
„meubles grecs“ von T. Sheraton mit Adler- und Löwenfiguren als<br />
Armlehnstützen und eingerollten Volutenfüssen) zu verzichten.<br />
Lit.: A. Chenevière, La splendeur du mobilier russe, Paris 1989; S. 65-71<br />
(Einflüsse von C. Cameron), S. 115 (Abb. 95, ein Fauteuil mit analoger<br />
Grundstruktur der Rückenlehne), S. 155-178 (biogr. Angaben zu A. Voronikhine,<br />
Abb. 155, 156, 158 und 178, verschiedene Fauteuils mit analogen oder ähnlichen<br />
Dekorations- und Konstruktionselementen). H. Honour, Chef d’oeuvres du mobilier,<br />
Fribourg 1971; S. 187-194 (mit Abb. des erwähnten Canapé „aux aigles“).<br />
G. Janneau, Le mobilier français - les sièges, Lüttich o.J.; S. 170f. (Abb. 322 und<br />
324, 2 Fauteuils von G. Jacob, mit ihrer originellen Formensprache ein möglicher<br />
Einfluss). E. Hohn, Stühle - von der Antike bis zur Moderne, München 1982; S.<br />
173 (Abb. 388/389, ein Fauteuil von T. Hope). M.Q. Flit / A.N. Gouzanov / L.V.<br />
Koval / Y.V. Moudrov, Pavlowsk - le Palais et le Parc, Paris 1991.<br />
CHF 60 000.- / 100 000.-<br />
(€ 37 500.- / 62 500.-)<br />
Siehe Abb.