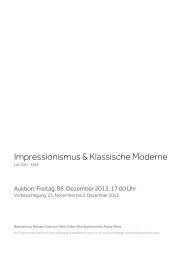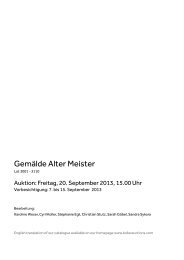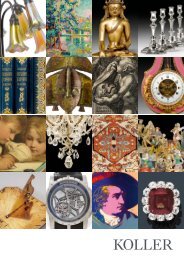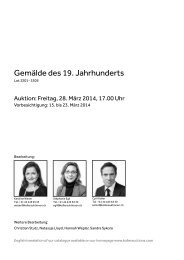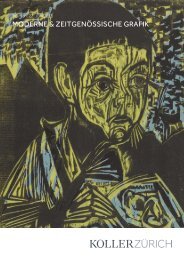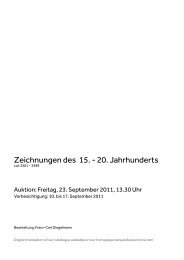Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen
Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen
Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
218<br />
MÖBEL, PENDULEN, BRONZEN, SPIEGEL, TAPISSERIEN UND DIVERSES<br />
1339*<br />
FÜRSTLICHER RUNDER SALONTISCH MIT „SCAGLIOLA“-<br />
PLATTE, Empire/Restauration, J. KLINCKERFUSS (Johannes Klinckerfuss,<br />
1770-1831) zuzuschreiben, mit Fragment des Inventarzettels<br />
„SCHLOSSINVENTAR CARLSRUHE“, Karlsruhe um 1810/20.<br />
Mahagoni, Nussbaum und Früchtehölzer teils beschnitzt mit Palmetten<br />
und Zierfries. Vorstehendes Blatt mit vertiefter „Scagliola“-<br />
Platte und Quadriga-Motiv - Pallas Athene auf von 4 Pferden<br />
gezogenem Wagen, begleitet von jungen Frauen -, auf gerader<br />
Zarge mit Balusterschaft, auf eingezogener Sockelplatte mit<br />
gequetschten Kugelfüssen. D 70 cm, H 80 cm.<br />
Provenienz:<br />
- Ehemals Bestand der fürstlichen Sammlungen von Schloss Karlsruhe.<br />
- Aus deutschem Besitz.<br />
Feiner Tisch von hoher Qualität. Er kann aufgrund der Inventaretikette nachweislich<br />
für die Jahre 1859 bis 1868 im Kleinen Kabinett eines Appartements im<br />
rechten Flügels des Karlsruher Schlosses eruiert werden: „5. Ein rundes Tischchen<br />
von Mahagoniholz mit schwarz gebeizter Säule, etwas Holzvergoldung, mit getiefter<br />
Platte von schwarzem Marmor, mit eingelegtem Siegeswagen in röthlicher<br />
Farbe“ (GLA 56/4100). 1868 wurde der Tisch in die Hauskämmerei gebracht:<br />
„Nr. 60. 1 runder Tisch aus (Mahagoniholz) mit schwarzer Säule und eingelegter<br />
Marmorplatte“ (GLA 56/4130). 1869 wurde er in das sog, „Schreib-Cabinettchen“<br />
im linken Flügel des Schlosses transferiert (GLA 564101). 1876 kam er aller<br />
Wahrscheinlichkeit ins Mannheimer Schloss, wie der zweite Inventarzettel vermuten<br />
lässt. Die Inventare von Mannheim sind jedoch derart kurz gehalten, dass<br />
eine genaue Identifizierung unseres Tisches nicht möglich ist.<br />
Das Karlsruher Schloss wurde 1715 als Residenz des Markgrafen Karl Wilhelm<br />
von Baden-Durlach errichtet. Baumeister des ursprünglichen Gebäudes war<br />
Jakob Friedrich von Batzendorf. 1746 musste es, ebenso wie die Stadt, umfang-<br />
1339 (Blatt)<br />
reich saniert und bei dieser Gelegenheit vollständig aus Stein gebaut werden,<br />
danach diente das Schloss 200 Jahre lang als Regierungssitz des badischen<br />
Herrscherhauses. Im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts wurde es grundlegend<br />
umgebaut, im Inneren mehrfach verändert und neu möbliert. 1849 wurde<br />
Großherzog Leopold von badischen Revolutionären aus dem Schloss vertrieben,<br />
endgültig verliess es die grossherzogliche Familie mit dem Ende der Monarchie im<br />
November 1918; bis dahin hatte das Schloss als Residenz der Markgrafen bzw.<br />
Grossherzöge von Baden gedient.<br />
Scagliola ist eine komplexe, bis ins Jahr 1500 nachweisbare, ursprünglich aus Italien<br />
und Griechenland stammende Kunsttechnik, bei der Gips, Farbpigmente und<br />
Knochenleim zu einem steinharten Material mit hoher Ausdruckskraft gemischt<br />
werden. Scagliola verleiht einer Oberfläche oder einem Gegenstand einen wärmeren<br />
Charakter, im Gegensatz zur kühlen Perfektion der Mosaike aus Stein. Das Bild-<br />
und Schmuckrepertoire der Scagliola basiert auf einem mimetischen und illusionistischen<br />
Spiel - sie wirkt auf den ersten Blick wie eine Marmorplatte oder eine<br />
Steinintarsie. Das Ergebnis ist allerdings das Verdienst des Künstlers, seiner technischen<br />
und malerischen Fertigkeiten, seines Geschmacks und seiner Kreativität.<br />
J. Klinckerfuss war Schüler von D. Roentgen und folgte diesem nach St. Petersburg.<br />
Anschliessend wurde er Hofebenist in Bayreuth beim Prinzen F.E. von<br />
Württemberg, dem er später nach Stuttgart folgte. Er heiratete die Tochter des<br />
Stuttgarter Ebenisten J.F. Schweickle, dessen Werkstatt er übernahm. Mit der Zeit<br />
löste er sich von den Vorbildern seines Meisters und fertigte, dem Geschmack der<br />
Zeit folgend, reine Empiremöbel.<br />
Lit.: G. Himmelheber, Die Kunst des deutschen Möbels - Klassizismus,<br />
Historismus, Jugendstil, München 1973; III, S. 67 (biogr. Angaben).<br />
CHF 60 000.- / 90 000.-<br />
(€ 37 500.- / 56 250.-)<br />
Siehe Abb.