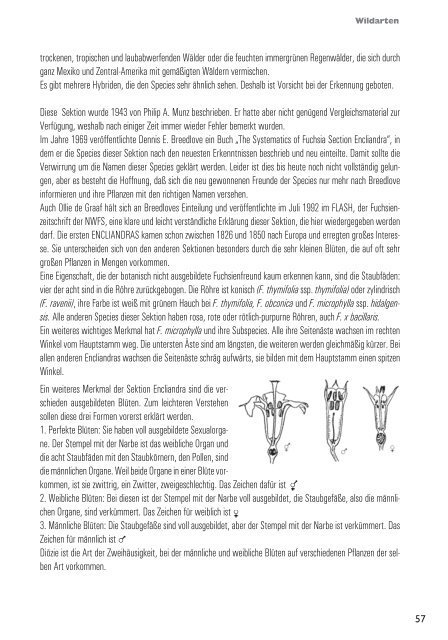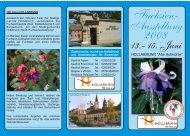25 Jahre - Gesellschaft Österreichischer Fuchsienfreunde
25 Jahre - Gesellschaft Österreichischer Fuchsienfreunde
25 Jahre - Gesellschaft Österreichischer Fuchsienfreunde
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wildarten<br />
trockenen, tropischen und laubabwerfenden Wälder oder die feuchten immergrünen Regenwälder, die sich durch<br />
ganz Mexiko und Zentral-Amerika mit gemäßigten Wäldern vermischen.<br />
Es gibt mehrere Hybriden, die den Species sehr ähnlich sehen. Deshalb ist Vorsicht bei der Erkennung geboten.<br />
Diese Sektion wurde 1943 von Philip A. Munz beschrieben. Er hatte aber nicht genügend Vergleichsmaterial zur<br />
Verfügung, weshalb nach einiger Zeit immer wieder Fehler bemerkt wurden.<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1969 veröffentlichte Dennis E. Breedlove ein Buch „The Systematics of Fuchsia Section Encliandra“, in<br />
dem er die Species dieser Sektion nach den neuesten Erkenntnissen beschrieb und neu einteilte. Damit sollte die<br />
Verwirrung um die Namen dieser Species geklärt werden. Leider ist dies bis heute noch nicht vollständig gelungen,<br />
aber es besteht die Hoffnung, daß sich die neu gewonnenen Freunde der Species nur mehr nach Breedlove<br />
informieren und ihre Pflanzen mit den richtigen Namen versehen.<br />
Auch Ollie de Graaf hält sich an Breedloves Einteilung und veröffentlichte im Juli 1992 im FLASH, der Fuchsienzeitschrift<br />
der NWFS, eine klare und leicht verständliche Erklärung dieser Sektion, die hier wiedergegeben werden<br />
darf. Die ersten ENCLIANDRAS kamen schon zwischen 1826 und 1850 nach Europa und erregten großes Interesse.<br />
Sie unterscheiden sich von den anderen Sektionen besonders durch die sehr kleinen Blüten, die auf oft sehr<br />
großen Pflanzen in Mengen vorkommen.<br />
Eine Eigenschaft, die der botanisch nicht ausgebildete Fuchsienfreund kaum erkennen kann, sind die Staubfäden:<br />
vier der acht sind in die Röhre zurückgebogen. Die Röhre ist konisch (F. thymifolia ssp. thymifolia) oder zylindrisch<br />
(F. ravenii), ihre Farbe ist weiß mit grünem Hauch bei F. thymifolia, F. obconica und F. microphylla ssp. hidalgensis.<br />
Alle anderen Species dieser Sektion haben rosa, rote oder rötlich-purpurne Röhren, auch F. x bacillaris.<br />
Ein weiteres wichtiges Merkmal hat F. microphylla und ihre Subspecies. Alle ihre Seitenäste wachsen im rechten<br />
Winkel vom Hauptstamm weg. Die untersten Äste sind am längsten, die weiteren werden gleichmäßig kürzer. Bei<br />
allen anderen Encliandras wachsen die Seitenäste schräg aufwärts, sie bilden mit dem Hauptstamm einen spitzen<br />
Winkel.<br />
Ein weiteres Merkmal der Sektion Encliandra sind die verschieden<br />
ausgebildeten Blüten. Zum leichteren Verstehen<br />
sollen diese drei Formen vorerst erklärt werden.<br />
1. Perfekte Blüten: Sie haben voll ausgebildete Sexualorgane.<br />
Der Stempel mit der Narbe ist das weibliche Organ und<br />
die acht Staubfäden mit den Staubkörnern, den Pollen, sind<br />
die männlichen Organe. Weil beide Organe in einer Blüte vorkommen,<br />
ist sie zwittrig, ein Zwitter, zweigeschlechtig. Das Zeichen dafür ist<br />
2. Weibliche Blüten: Bei diesen ist der Stempel mit der Narbe voll ausgebildet, die Staubgefäße, also die männlichen<br />
Organe, sind verkümmert. Das Zeichen für weiblich ist<br />
3. Männliche Blüten: Die Staubgefäße sind voll ausgebildet, aber der Stempel mit der Narbe ist verkümmert. Das<br />
Zeichen für männlich ist<br />
Diözie ist die Art der Zweihäusigkeit, bei der männliche und weibliche Blüten auf verschiedenen Pflanzen der selben<br />
Art vorkommen.<br />
57