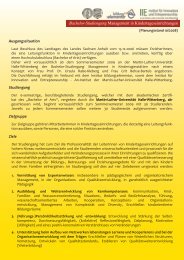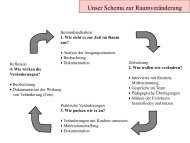6 Integrative Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ - Kitas im Dialog
6 Integrative Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ - Kitas im Dialog
6 Integrative Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ - Kitas im Dialog
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schlussbetrachtung 130<br />
8 Schlussbetrachtung<br />
Diese Arbeit zielte darauf ab, zu überprüfen, inwieweit die neuen Anforderungen, die das<br />
Bildungsprogramm „Bildung: elementar“ an die Erzieherinnen stellt, erfüllt werden können<br />
und in welchen Bereichen das Programm an Grenzen stößt. Für die abschließende<br />
Betrachtung der Möglichkeiten und Einschränkungen von „Bildung: elementar“, sollen<br />
vorerst in einer zusammenfassenden Darstellung, die Vorraussetzungen in der Kita <strong>„Käthe</strong><br />
<strong>Kollwitz“</strong>, sowie die Anforderungen an die Erzieherinnen herausgearbeitet werden. Überdies<br />
sollen dabei die Ergebnisse der Interviews und der Fragebögen berücksichtigt werden.<br />
Die „Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen<br />
Persönlichkeit“ (KJHG, 1998, §22) zu fördern stellt den Auftrag an die <strong>Kindertagesstätte</strong>n<br />
dar. Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes bilden dabei den Aufgabenbereich der<br />
Erzieherinnen, mit dem sie Familien in ihrer Erziehung unterstützen (vgl. KJHG, 1998, §22).<br />
Seit dem schlechten Abschneiden der deutschen Schüler bei der PISA-Studie gab es<br />
allerdings viele Diskussionen über die Bildungsqualität in Deutschland. Seitdem wird<br />
gefordert, dass vor allem <strong>im</strong> Elementarbereich dem Aspekt der Bildung eine größere<br />
Bedeutung beigemessen werden muss. Aus diesem Grund wurden bereits in vielen<br />
Bundesländern von den zuständigen Ministerien Bildungspläne für <strong>Kindertagesstätte</strong>n<br />
veröffentlicht. Diese zielen allerdings nicht auf eine „Verschulung von Kindergärten“ (Quelle<br />
16, S.1) ab, sondern dienen als Orientierung, die verschiedene Bildungsbereiche detailliert<br />
beschreiben und die Aufgaben der Erzieherinnen definieren. Diese Bildungspläne können<br />
jedoch nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich das Verständnis von Bildung, Erziehung<br />
und Betreuung verändert.<br />
Bildung sollte dabei als Eigenaktivität des Kindes und nicht als Belehren durch den<br />
Erwachsenen verstanden werden. Seit Humboldt wird die Selbstbildung des Kindes als<br />
„Aneignung von Welt“ definiert. Kinder setzen sich dabei in Beziehung zu Personen oder<br />
Gegenständen aus ihrer Umgebung und errichten auf Grundlage ihrer bereits gesammelten<br />
Erfahrungen eine zweite Realitätsebene. Kinder erforschen die Welt und stellen Hypothesen<br />
über sie und ihre Beziehung zu ihr auf, die sie aufgrund ihrer Entdeckungen und bereits<br />
gemachter Erfahrungen weiterentwickeln oder korrigieren. Kinder treten in den ersten<br />
Lebensjahren als Forscher und Forscherinnen auf und lernen durch eigenes Tun.