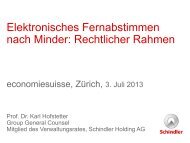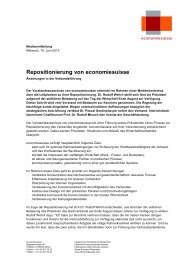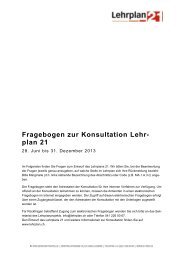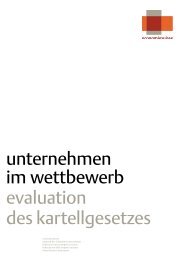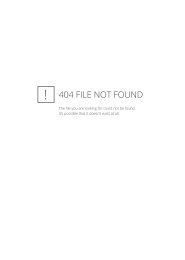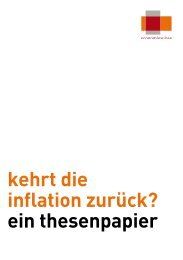Wer finanziert den Staat in der Schweiz? - Economiesuisse
Wer finanziert den Staat in der Schweiz? - Economiesuisse
Wer finanziert den Staat in der Schweiz? - Economiesuisse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schlussfolgerungen<br />
des Bundesrats bis 2025 von e<strong>in</strong>er zusätzlichen Verschuldung<br />
von 125 Mrd. Franken (15 Prozent vom<br />
BIP) aus. Hauptursache dieser Fehlentwicklung ist die<br />
heute schon absehbare Kostenexplosion im Bereich<br />
<strong>der</strong> Sozialen Wohlfahrt. Ohne tiefgreifende Strukturreformen<br />
droht e<strong>in</strong> Verdrängungsprozess, <strong>der</strong><br />
die Handlungsfähigkeit des <strong>Staat</strong>es <strong>in</strong>sgesamt tangieren<br />
wird.<br />
— Das ausgaben<strong>in</strong>duzierte Verschuldungsproblem<br />
<strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> ist <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Weise Resultat fehlen<strong>der</strong><br />
<strong>Staat</strong>se<strong>in</strong>nahmen: Seit 1970 s<strong>in</strong>d die E<strong>in</strong>nahmen<br />
des <strong>Staat</strong>es nur gestiegen. Sie haben sich – trotz<br />
zahlreicher Steuerreformen vor allem <strong>in</strong> <strong>den</strong> Kantonen<br />
– mehr als versechsfacht (vgl. Abbildung 52).<br />
Das ist ausserdem auch deutlich mehr als das Wirtschaftswachstum<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong>selben Periode. Sowohl die<br />
E<strong>in</strong>nahmen aus <strong>der</strong> Ertragssteuer von Unternehmen<br />
als auch die E<strong>in</strong>nahmen aus <strong>der</strong> E<strong>in</strong>kommenssteuer<br />
von Privatpersonen haben – gegenüber<br />
übrigen Formen von <strong>Staat</strong>se<strong>in</strong>nahmen – deutlich<br />
überproportional zugenommen. Das <strong>Schweiz</strong>er<br />
System des Steuerwettbewerbs bei <strong>den</strong> direkten<br />
Steuern – und die damit verbun<strong>den</strong>e Reformdynamik<br />
auf Kantonsebene – hat deshalb <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Art<br />
und Weise die deutliche Zunahme von <strong>Staat</strong>smitteln<br />
<strong>in</strong> <strong>den</strong> letzten Jahren bee<strong>in</strong>trächtigt. Im Gegenteil.<br />
Die These des «ru<strong>in</strong>ösen Steuerwettbewerbs»<br />
bzw. des «race to the bottom» lässt sich damit nicht im<br />
Ger<strong>in</strong>gsten faktisch untermauern. Die <strong>Schweiz</strong> hat<br />
ke<strong>in</strong> E<strong>in</strong>nahmen, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong> Ausgabenproblem.<br />
2<br />
4.3 Gesamtbeurteilung<br />
Auf Basis <strong>der</strong> Studienergebnisse und unter Berücksichtigung<br />
des f<strong>in</strong>anzpolitischen Gesamtkontextes lassen<br />
sich folgende Schlüsse ziehen:<br />
Aussagekräftige Ergebnisse zur F<strong>in</strong>anzierungsseite<br />
− Ausgabenanalyse noch ausstehend. «<strong>Wer</strong> <strong>f<strong>in</strong>anziert</strong><br />
<strong>den</strong> <strong>Staat</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong>» beantwortet mit Bezug<br />
auf das gesamte <strong>Schweiz</strong>er Steuersystem ausschliesslich<br />
die Frage, wer <strong>den</strong> <strong>Staat</strong> <strong>in</strong> welchem Umfang <strong>f<strong>in</strong>anziert</strong>.<br />
E<strong>in</strong>e Gesamtbeurteilung <strong>der</strong> Umverteilung<br />
aus f<strong>in</strong>anzpolitischer Sicht wird erst möglich se<strong>in</strong>,<br />
wenn auch die Leistungsseite, d.h. die Verteilung <strong>der</strong><br />
Ausgaben auf die verschie<strong>den</strong>en Empfänger und Empfängergruppen,<br />
vollständig analysiert und mit <strong>den</strong><br />
hier vorliegen<strong>den</strong> Ergebnissen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gebracht<br />
wird. Um <strong>den</strong> Umfang und die Qualität <strong>der</strong> Umverteilung<br />
für die <strong>Schweiz</strong> mit ihren speziellen Verhältnissen<br />
abschliessend beurteilen zu können, wäre e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationaler<br />
Vergleich wünschenswert. Nach heutigem<br />
Kenntnisstand sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e solche Studie für e<strong>in</strong> mit<br />
<strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> vergleichbares Land nicht vorzuliegen.<br />
Beachtliche Zwangssolidarität bzw. Umverteilung<br />
von oben nach unten. Das obere Segment <strong>der</strong> Privatpersonen<br />
und die Unternehmen tragen zusammen<br />
rund 60 Prozent zu <strong>den</strong> E<strong>in</strong>nahmen des <strong>Staat</strong>es bei.<br />
In diesem S<strong>in</strong>n besteht im schweizerischen fö<strong>der</strong>alen<br />
Steuersystem e<strong>in</strong>e ausgeprägt solidarische Komponente<br />
von <strong>den</strong> oberen zu <strong>den</strong> unteren E<strong>in</strong>kommens<br />
und Vermögensgruppen sowie von <strong>der</strong> Wirtschaft zu<br />
<strong>den</strong> privaten Haushalten. Bei <strong>den</strong> Privatpersonen<br />
steuert das obere Segment verhältnismässig über<br />
dreimal mehr als <strong>der</strong> Mittelstand und etwa siebenmal<br />
mehr als das untere Segment zur F<strong>in</strong>anzierung des<br />
<strong>Staat</strong>es bei. Der Mittelstand leistet verhältnismässig<br />
doppelt soviel wie das untere Segment. Mit Bezug auf<br />
das Steuersystem erweist sich damit die immer wie<strong>der</strong><br />
verbreitete These <strong>der</strong> «Umverteilung von unten nach<br />
oben» bzw. <strong>der</strong> «Entsolidarisierung» als nicht stichhaltig<br />
– sie muss konsequent kritisch h<strong>in</strong>terfragt wer<strong>den</strong>.<br />
Mittelstand und unteres Segment profitieren direkt<br />
von e<strong>in</strong>em standortattraktiven Steuersystem. Die<br />
Analyse <strong>der</strong> E<strong>in</strong>nahmenzuflüsse des <strong>Staat</strong>es zeigt,<br />
dass e<strong>in</strong> Steuersystem, das für f<strong>in</strong>anzkräftigere Privatpersonen<br />
und <strong>in</strong>ternational mobilere Produktions<br />
faktoren (Unternehmen und Arbeitskräfte) attraktiv<br />
bleibt, nicht im Wi<strong>der</strong>spruch zu e<strong>in</strong>em solidarischen<br />
Steuersystem steht. Im Gegenteil. Alle Steuerreformen<br />
<strong>der</strong> vergangenen Jahre, die diese Kreise entlasteten<br />
und gleichzeitig <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> bzw. verschie<strong>den</strong>en<br />
Kantonen erlaubten, im <strong>in</strong>ternationalen Steuerwettbewerb<br />
an <strong>der</strong> Spitze zu bleiben, wur<strong>den</strong> als verme<strong>in</strong>tliche<br />
«Steuergeschenke an Reiche und Unternehmen»<br />
deklassiert. Solche Steuerreformen brachten aber