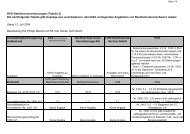Dezember - Anwaltsblatt
Dezember - Anwaltsblatt
Dezember - Anwaltsblatt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AnwBl 12/2005 785<br />
HAFTPFLICHTFRAGEN<br />
Der Schadensbegriff in der<br />
Anwaltshaftung<br />
Rechtsanwältin Antje Jungk,<br />
Allianz Versicherungs-AG, München<br />
In vielen Anwaltshaftungsfällen ist eine Verletzung von<br />
Pflichten aus dem Mandatsvertrag offensichtlich, beispielsweise<br />
bei der Versäumung von Fristen. Das Verschulden<br />
ist regelmäßig indiziert. Dass sich daraus aber nicht<br />
automatisch ein kausaler Schaden ergibt, ist aus Sicht des<br />
betroffenen Mandanten manchmal schwer nachvollziehbar:<br />
Das subjektiv-laienhafte Gefühl „geschädigt“ zu sein<br />
steht nicht immer im Einklang mit dem Ergebnis der juristischen<br />
Betrachtungsweise.<br />
Rechtsanwältin Antje Jungk<br />
aus München.<br />
I. Abgrenzung von Schaden und<br />
Schadenskausalität<br />
1. Der Schadensbegriff<br />
Wann kann man eigentlich von einem „Schaden“ sprechen?<br />
Eine gesetzliche Definition hierzu fehlt. Der objektive<br />
Zustand einer Sache oder eine bestimmte Vermögenssituation<br />
allein begründen noch keinen Schaden. Ein<br />
Schaden ergibt sich immer erst aus einem Zustandsvergleich<br />
einer Sache oder eines Vermögens zu zwei verschiedenen<br />
Zeitpunkten, nämlich vor und nach der schädigenden<br />
Handlung. Ein beschädigtes Fahrzeug führt nur dann zu einem<br />
Schaden des Eigentümers, wenn es vor der Schädigungshandlung<br />
nicht oder weniger beschädigt war. In Anwaltshaftungsfällen<br />
geht es in der Regel aber nicht um die<br />
Beschädigung einzelner Gegenstände, sondern um die<br />
Schädigung des Vermögens des Mandanten. Hier stellt sich<br />
der Vergleich zu zwei verschiedenen Zeitpunkten etwas<br />
komplexer dar. Auf den ersten Blick ist die Vermögenssituation<br />
vor und nach einem – durch Anwaltsverschulden<br />
– verlorenen Aktivprozess gleich (jedenfalls wenn die Kosten<br />
durch einen Rechtsschutzversicherer übernommen werden).<br />
Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass die noch<br />
nicht gerichtlich geltend gemachte Forderung vor Prozessbeginn<br />
schon ein Aktivum in der persönlichen Vermögensbilanz<br />
war, das nach verlorenem Prozess „auszubuchen“<br />
ist. Jedem Mandatsvertrag liegt ja ein potenzieller Anspruch<br />
zu Grunde, der dem Vermögen auf der Aktiv- oder<br />
Passivseite zuzurechnen ist. Ein begründeter Anspruch, der<br />
nicht durchgesetzt wird, stellt dann genauso einen Schaden<br />
dar wie die unbegründete Forderung gegen den Mandanten,<br />
die gleichwohl tituliert wird.<br />
MN<br />
2. Abgrenzung der Kausalitätsfrage<br />
Bereits an dieser Stelle zeigt sich, dass die Abgrenzung<br />
zwischen dem Schadensbegriff an sich und der Frage nach<br />
der Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für den Schaden<br />
schwierig ist. Nehmen wir den Fall, dass eine unzweifelhaft<br />
begründete Forderung des Mandanten durch Verschulden des<br />
Rechtsanwalts verjährt und demzufolge nicht mehr durchsetzbar<br />
ist. Es ist dann eine Voraussetzung des Schadens<br />
selbst, dass der Anspruch überhaupt materiell-rechtlich begründet<br />
war. Wenn der Schuldner aber bereits vor der Pflichtverletzung<br />
vermögenslos war, käme man bei dem Vermögensvergleich<br />
mangels Werthaltigkeit der Forderung<br />
dazu, dass gar kein Schaden entstanden ist. Ist die Vermögenslosigkeit<br />
hingegen erst nach der anwaltlichen Pflichtverletzung<br />
eingetreten, käme man zunächst zu einem Schaden.<br />
Ob der Schadenseintritt auch in Ansehung der<br />
Vermögenslosigkeit des Schuldners durch die Pflichtverletzung<br />
„verursacht“ wurde, gehört dann zur Kausalitätsprüfung.<br />
Ähnlich verhält es sich mit der versäumten Rechtsmittelfrist:<br />
Die Nichtdurchführbarkeit des Rechtsmittelverfahrens<br />
selbst ist an sich kein Schaden. Dieser ergibt sich erst aus<br />
dem Vergleich zwischen der Situation vor Fristversäumung<br />
(zwar klageabweisendes Urteil, aber die Chance, den Anspruch<br />
doch noch zugesprochen zu bekommen) und nachher<br />
(endgültige Klageabweisung). Um das Vermögen vor<br />
Ablauf der Berufungsfrist zu beziffern, müsste man die<br />
Werthaltigkeit des Anspruchs prüfen, also dessen objektive<br />
Begründetheit. Dennoch wird diese Frage regelmäßig unter<br />
dem Stichwort „hypothetischer Kausalverlauf“ bzw. „hypothetischer<br />
Vorprozess“ untersucht. Die Beispiele zeigen,<br />
dass eine strenge dogmatische Trennung von Schaden und<br />
Schadenskausalität kaum möglich ist.<br />
II. Die Schadensproblematik in der jüngeren<br />
Rechtsprechung<br />
Unbeschadet der eben aufgezeigten Abgrenzungsprobleme<br />
sind bestimmte Fallgruppen zumindest schwerpunktmäßig<br />
beim eigentlichen Schadensbegriff anzusiedeln. Die<br />
Differenzhypothese besagt, dass die jeweilige Vermögenssituation<br />
vor und nach der schädigenden Handlung gegenüber<br />
zu stellen sind. Im Einzelnen kann hier aber vieles<br />
zweifelhaft sein.<br />
1. Betroffene Vermögenspositionen<br />
Das Gesamtvermögen eines Mandanten kann mehr oder<br />
weniger umfangreich sein und der Bestand verändert sich<br />
praktisch täglich. Niemand würde wohl auf die Idee kommen,<br />
den Verlust eines Regenschirms in der U-Bahn als einen<br />
Schaden anzusehen, der durch einen vom Rechtsanwalt<br />
verschuldeten ungünstigen Unterhaltsvergleich verursacht<br />
wurde. Es muss also darum gehen, die potenziell von dem<br />
Anwaltsfehler betroffenen Vermögenspositionen zu bestimmen.<br />
Die Rechtsprechung stellt dabei auf den Schutzzweck<br />
des verletzten Beratungsvertrages ab. Bei fehlerhafter Beratung<br />
über die steuerlichen Vorteile einer gesellschaftsrechtlichen<br />
Beteiligung kommt demzufolge auch nur eine Haftung<br />
für ausgebliebene Steuervorteile, nicht für einen<br />
ausgebliebenen Unternehmenserfolg in Betracht (BGH<br />
NJW-RR 2003, 1035). Strafrechtliche Sanktionen können