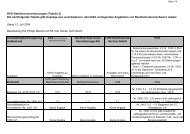Dezember - Anwaltsblatt
Dezember - Anwaltsblatt
Dezember - Anwaltsblatt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AnwBl 12/2005 XXVII<br />
Felix Hey: Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen<br />
und Ihre Schranken,<br />
Münchner Universitätsschriften<br />
Band 190,Verlag C.H. Beck, 385 Seiten,<br />
50,00 E.<br />
Gesellschaftsverträge unterscheiden<br />
sich von Austauschverträgen durch einen<br />
wesentlichen Gesichtspunkt: Beim<br />
Austauschvertrag sind die Parteien<br />
zwar durch das Seil der synallagmatischen<br />
Verbindung aneinandergekettet,<br />
ziehen aber jeweils in die andere Richtung.<br />
Deshalb müssen schwächere Vertragspartner<br />
wie Verbraucher und unerfahrene<br />
Kaufleute geschützt werden,<br />
damit die andere Seite sie nicht über<br />
den Tisch zieht. Beim Gesellschaftsvertrag<br />
hingegen sitzen die Gesellschafter<br />
in einem Boot und müssen gemeinsam<br />
in Richtung auf das<br />
definierte Ziel rudern. Deshalb gibt es<br />
im allgemeinen Gesellschaftsrecht nur<br />
allgemeine Schutzbestimmungen, wie<br />
den Verstoß gegen die guten Sitten,<br />
den Wegfall der Geschäftsgrundlage<br />
oder ähnliche. Sie sind bisher kaum<br />
systematisch aufgearbeitet worden.<br />
Felix Hey hat in seiner Münchener<br />
Habilitationsschrift diese Lücke geschlossen.<br />
Sie ist auf hohem und teilweise<br />
sehr abstraktem wissenschaftlichen<br />
Niveau geschrieben, aufgrund<br />
ihrer klaren Gliederung und ebenso<br />
klaren Sprache aber auch für den Anwalt<br />
unmittelbar verwendbar.<br />
Die moderne Kapitalmarktentwicklung<br />
und die Bildung von Eigentum<br />
auf breiter Front hat Publikumsgesellschaften,<br />
Kleinaktionäre, Genossen<br />
und viele andere „Gesellschafter“ entstehen<br />
lassen, die in Wirklichkeit Verbraucher<br />
von Finanzprodukten sind.<br />
Hey zeigt, wie sie geschützt werden<br />
können und gliedert die Schutzformen<br />
überzeugend in: Zwingendes Recht,<br />
Schutz der Entscheidungsfreiheit, Inhaltskontrolle<br />
und Ausübungskontrolle.<br />
Seine Studie geht den einzelnen<br />
Schutzformen detailliert nach, zeigt<br />
ihre theoretischen Grundlagen und immer<br />
wieder beispielhaft auch die praktischen<br />
Auswirkungen. Seine Lösungsvorschläge<br />
sind durchweg<br />
überzeugend. Dies gilt auch für jene<br />
Bereiche, in denen das Gesellschaftsrecht<br />
gleichstarke Partner miteinander<br />
verbindet, wie etwa in einer Anwaltssozietät.<br />
Den Ansatz der Rechtsprechung,<br />
das Kündigungsrecht gegen einen<br />
Gesellschafter nur an der<br />
Sittenwidrigkeitsschranke festzumachen,<br />
kritisiert Hey und fordert eine<br />
Gesamtschau der gesellschaftsrechtlichen<br />
Struktur, die sich schon weit un-<br />
terhalb der Sittenwidrigkeitsschwelle<br />
zum Beispiel am Gleichbehandlungsgrundsatz<br />
orientieren muss. Ein Olympiaachter,<br />
in dem nur Leistungssportler<br />
sitzen, hat eine andere Struktur als<br />
eine privat genutzte Zwei-Mann-Jolle.<br />
Erst wenn man diese Unterschiede gedanklich<br />
erfasst hat, kann man die<br />
Frage nach der Sittenwidrigkeit einzelner<br />
Regelungen sinnvoll stellen. So<br />
gibt es zum Beispiel in eine echten<br />
Anwaltspartnerschaft keinen vernünftigen<br />
Grund dafür, einem Gesellschafter<br />
der seinen Gesellschaftsanteil ohne<br />
Vergütung erhalten hat, wie dies bei<br />
Anwaltssozietäten durchaus üblich ist,<br />
einen Abfindungsanspruch zuzubilligen,<br />
wenn der Gesellschaftsvertrag<br />
dies ausdrücklich ausschließt. Die<br />
Rechtsprechung hat bisher keinen vernünftigen<br />
Ansatz zur Lösung solcher<br />
Themen gefunden und Heys Arbeit<br />
zeigt, wo man sie suchen muss. Dass<br />
er dabei auch auf die verfassungsrechtlichen<br />
Wurzeln der Vertragsfreiheit<br />
hinweist, ist ein besonderer Verdienst.<br />
Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen,<br />
Berlin<br />
Stackmann, Nikolaus, Rechtsbehelfe<br />
im Zivilprozess, C.H. Beck, 1. Aufl.<br />
2004, München, kartoniert, 455 S.,<br />
32,00 E<br />
Der Titel des Buches zeigt bereits,<br />
worum es geht: Wie kann im Zivilprozess<br />
gegen gerichtliche Entscheidungen<br />
vorgegangen werden? Der Autor,<br />
Vorsitzender Richter einer Berufungsund<br />
Beschwerdekammer am LG München<br />
I und Autor wissenschaftlicher<br />
Aufsätze, gibt eine Übersicht über<br />
Rechtsbehelfe gegen Urteile der ersten<br />
Instanz, im Rechtsmittelverfahren und<br />
gegen andere gerichtliche Anordnungen.<br />
Dabei wird Wert auf das materielle<br />
Vorgehen, aber auch auf das Betrachten<br />
der Kostenseite gelegt.<br />
Stackmann beschreibt im ersten<br />
Teil die Möglichkeiten nach verschiedenen<br />
Entscheidungen. Schwerpunkt<br />
ist das Vorgehen gegen Urteile der ersten<br />
Instanz. Dazu gehört vor allem<br />
die Berufung. Die Voraussetzungen<br />
und Besonderheiten der Berufung werden<br />
dargestellt. Fristen sind dabei genauso<br />
zu beachten, wie die verschiedenen<br />
Rügemöglichkeiten für die<br />
Berufungsbegründung.<br />
Der zweite Teil befasst sich schwerpunktmäßig<br />
mit dem Vorgehen gegen<br />
Berufungsurteile. Dabei stehen die<br />
Grundlagen und Begründungen der<br />
Nichtzulassungsbeschwerde und der<br />
Revision im Mittelpunkt.<br />
MN<br />
Da Entscheidungen nicht nur durch<br />
Urteile ergehen, folgt ein dritter Teil,<br />
in dem Stackmann auch das Vorgehen<br />
gegen diese Entscheidungen, wiederum<br />
unter Berücksichtigung der Formalien<br />
und Kosten, dar. Dazu gehören<br />
z. B. Beschwerden oder Erinnerungen.<br />
Stackmann wendet sich mit seinem<br />
Aufbau an Praktiker, womit vor allem<br />
Richter und Rechtsanwälte gemeint<br />
sind. Gerade für Rechtsanwälte ist das<br />
Buch hilfreich, da sich am Ende der<br />
einzelnen Kapitel kostenrelevante<br />
Überlegungen nach RVG und BRAGO<br />
sowie die Bezifferung der Gerichtsund<br />
Parteikosten finden. Dies ist für<br />
die wirtschaftliche Abschätzung der<br />
Folgen der einzelnen Handlungen<br />
wertvoll. Der Rechtsanwalt kann so<br />
entscheiden, ob ein Angriff gegen Gerichtsentscheidungen<br />
wirtschaftlich<br />
sinnvoll ist. Darüber hinaus wird mit<br />
diesem Werk ein insgesamt kompakter<br />
und guter Überblick über die Verfahrensabläufe<br />
und -schritte gegeben.<br />
Rechtsanwalt Marc-André Delp,<br />
M.L.E., Hannover