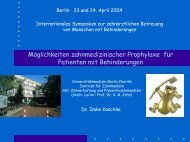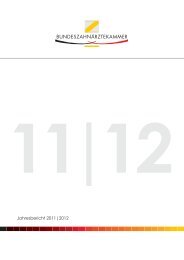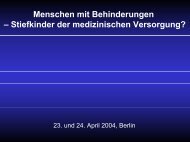Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grußsw<br />
ort<br />
| 110<br />
Präventionsorientierte Zahnheilkunde als umfassende Gesundheitsbetreuung ein Leben lang<br />
ihrer Wirksamkeit und Absicherung negativer<br />
Nebeneffekte abgesichert sein muss. Ganz<br />
wesentlich werden alle Strategien getragen von<br />
der Information und Beratung der Patienten,<br />
denn nur eine allgemein akzeptierte Prävention<br />
kann wirken und eine erwartete Breitenwirkung<br />
entfalten.<br />
Präventive Anreize in den Finanzierungssystemen<br />
und Verschuldungsprinzip<br />
In der Zahnmedizin bestehen in Deutschland<br />
seit langem, allerdings nur im Bereich der<br />
Tertiärprävention finanzielle Anreize durch einen<br />
höheren Erstattungsanspruch, wenn regelmäßig<br />
eine zahnärztliche Behandlung bzw. Diagnostik<br />
in Anspruch genommen wurde. <strong>Die</strong>se Anreize<br />
zeigen durchaus positive Auswirkungen auf die<br />
Frequenz der Teilnahme an regelmäßigen, präventiven<br />
Untersuchungen, wobei die finanziellen<br />
Anreize über die prothetischen Leistungen<br />
hinaus ausgeweitet werden könnten. Sinnvoller<br />
wäre auch ein direkter Bezug zu der Inanspruchnahme<br />
präventiver Leistungen. Es bestehen<br />
keine Ansätze, das Mundgesundheitsverhalten<br />
bzw. die persönliche Zahnhygiene befundorientiert,<br />
z.B.: orientiert am Plaque-Index, zu fördern,<br />
obwohl dies eine sachgerechte aber kaum<br />
realisierbare Alternative darstellen würde. Da in<br />
der jetzigen Systematik über die Zuzahlungsregelungen<br />
in der Prothetik persönliche Anreize<br />
gesetzt werden, würden dies bei einer Herausnahme<br />
der prothetischen Leistungen aus der<br />
GKV entfallen, oder es kommt zu Querbezügen<br />
in zwei völlig unterschiedlichen Versorgungssystemen.<br />
Da eine regelmäßige häusliche Mundhygiene<br />
ein wesentlicher Baustein der Prophylaxe<br />
für die wichtigsten Zahnerkrankungen Karies<br />
und Parodontose darstellt, wurde in Kombination<br />
mit der professionellen Zahnreinigung und<br />
lokalen sowie systemischen Fluoridierung sehr<br />
rasch die Eigenverantwortung des Patienten für<br />
diese Erkrankungen in den Mittelpunkt gesellschaftlicher<br />
Diskussionen gestellt. <strong>Die</strong>se beiden<br />
Erkrankungen werden dadurch gleichsam im<br />
Verschuldungsprinzip als eigenverantwortete<br />
Bereiche außerhalb der Leistung der GKV diskutiert.<br />
<strong>Die</strong>ser Ansatz ist neben den ethischen<br />
Bedenken gegen diesen Ansatz der Verschuldung<br />
als Maßstab der GKV-Finanzierung auch<br />
objektiv falsch, da keineswegs nur die persönliche<br />
Hygiene die Frequenz und vor allem den<br />
Ausprägungs- und Verlaufsgrad dieser Erkran-<br />
kungen bestimmt. Deutlich widersprochen werden<br />
muss daher den häufigen Aussagen, dass<br />
die oralen Erkrankungen durch Eigenverantwortung<br />
vermeidbare Erkrankungen seien und<br />
durch Umsteuerung der Finanzierung eine Verbesserung<br />
der Prävention erreicht werden<br />
könne, wozu fälschlicherweise die Situation in<br />
der Schweiz argumentativ vorgebracht wird<br />
(Staehle and Kerschbaum 2003).<br />
Eine weitgehende Entlassung der prothetischen<br />
Versorgung in ihren sehr unterschiedlichen<br />
Möglichkeiten und Leistungsumfängen in<br />
die finanzielle Eigenverantwortung und nur das<br />
Belassen einer befundorientierten präventiven<br />
Basisversorgung in der Solidarabsicherung und<br />
gleichzeitig erhaltener individueller Freiheit der<br />
Therapieauswahl durch Bestimmung des gewünschten<br />
Leistungsumfangs als Mehrkostenregelung<br />
wären ein indirekt wirksamer präventiver<br />
Ansatz in den sozialen Finanzierungssystemen.<br />
Selbstverständlich kann diese Regelung auf<br />
alle restaurativen Maßnahmen der Tertiärprävention<br />
übertragen werden, in denen fast durchgehend<br />
unterschiedlich aufwendige Therapieformen<br />
zur Verfügung stehen, deren Zielsetzung<br />
keineswegs immer präventiv, sondern durch verständliche<br />
Ansprüche an Ästhetik und Komfort<br />
wesentlich bestimmt werden. Statt wissenschaftlich<br />
und sozialpolitisch kaum vertretbarer Leistungsausgrenzung<br />
würden befundorientierte<br />
Festzuschüsse die präventive Basisversorgung<br />
für die gesamte Bevölkerung absichern und die<br />
Bestimmung des darüber hinausgehenden Leistungsumfangs<br />
in die Entscheidung und Verantwortung<br />
des mündigen Patienten legen.<br />
Zukunft einer ganzheitlichen Prävention<br />
durch eine prädiktive Risikoanalyse und<br />
risikoadaptierte Prävention<br />
<strong>Die</strong> Zukunft der ganzheitlichen Prävention<br />
liegt vor allem in der Sensibilisierung der Bevölkerung<br />
durch sachgerechte Information und<br />
Bewusstseinsbildung, die durch Erziehung im<br />
umfassenden Sinne durch Vorbild, Schule, Fachkräfte<br />
und Medien erfolgen kann. Daneben<br />
müssen organisatorische Vorgaben (globale<br />
Strategien: z.B. fluoridiertes Speisesalz) und<br />
sozialpolitische Anreize weitergehend versucht<br />
werden, die die Eigenverantwortung des Patienten<br />
anregen.<br />
Begleitet werden müssen diese Maßnahmen<br />
allerdings mit einer epidemiologischen Versorgungsforschung,<br />
die auch die Effektivität und