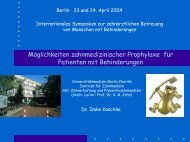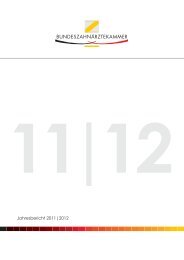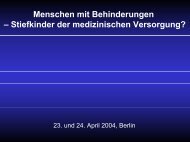Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Grußsw<br />
ort<br />
| 88<br />
Wettbewerb und Umverteilung im Gesundheitswesen<br />
einkünften zahlen müssen. <strong>Die</strong> freiwillig Versicherten<br />
haben aber im Vergleich zu den<br />
Pflichtversicherten in aller Regel in erheblich<br />
größerem Umfang außerhalb von Renten- und<br />
Pensionssystemen für ihr Alter vorgesorgt und<br />
erzielen entsprechend höhere Vermögenseinkünfte.<br />
Hier stoßen zwei unterschiedliche<br />
Systeme aufeinander, die grundsätzlich nicht<br />
kompatibel sind, so dass die Umverteilungsidee<br />
der gesetzlichen Krankenversicherung weiter<br />
verfälscht wird.<br />
Eine geradezu systemsprengende Wirkung<br />
kann die intergenerative Umverteilung in den<br />
nächsten <strong>Jahre</strong>n entwickeln. <strong>Die</strong> gesetzliche<br />
Krankenversicherung beruht auf dem Umlageprinzip.<br />
Bei der sich ändernden Altersstruktur,<br />
wie wir sie im Augenblick erleben und wie sie<br />
verstärkt in den <strong>Jahre</strong>n nach 2010 eintreten<br />
wird, steigt der Anteil der Versicherten, die das<br />
Gesundheitssystem mit höheren Kosten belasten<br />
als sie an Beiträgen aufbringen. <strong>Die</strong> steigende<br />
Lebenserwartung und die geringe Geburtenrate<br />
bewirken eine erhebliche Zunahme des Durchschnittsalters<br />
der Bevölkerung, so dass es relativ<br />
weniger junge Menschen gibt, die mehr einzahlen<br />
als die Versicherung für sie aufwenden muss.<br />
Schon aus diesen Gründen werden die Beitragssätze<br />
weiter steigen, so dass die künftigen Generationen<br />
mit höheren Beiträgen belastet werden,<br />
wenn nicht bald damit begonnen wird, Rückstellungen<br />
zu bilden.<br />
Grundsätzlich sollen die Versicherten entsprechend<br />
ihrer Leistungsfähigkeit in die gesetzliche<br />
Krankenversicherung einzahlen. <strong>Die</strong> angestrebte<br />
Umverteilung nach der Leistungsfähigkeit<br />
wurde vor mehr als 100 <strong>Jahre</strong>n, als die<br />
gesetzliche Krankenversicherung eingeführt<br />
wurde, einigermaßen erreicht. Damals musste<br />
nahezu jeder Arbeitnehmer seine volle verfügbare<br />
Zeit in seinem Beschäftigungsverhältnis<br />
einsetzen, um sich und seine Familie ernähren<br />
zu können. Einkünfte aus Vermögen spielten für<br />
die Arbeitnehmer praktisch keine Rolle, so dass<br />
das Arbeitseinkommen ein vergleichsweise guter<br />
Indikator für die Leistungsfähigkeit der Versicherten<br />
war.<br />
Mit dem Einkommen aus unselbständiger<br />
Arbeit wird aber heute die Leistungsfähigkeit<br />
nicht mehr zutreffend erfasst. <strong>Die</strong> Möglichkeiten,<br />
mit anderen Tätigkeiten Einkünfte zu erzielen<br />
– beispielsweise durch Vermietung und<br />
Verpachtung – nehmen ständig zu. Ein großer<br />
Anteil der Haushalte hat Vermögen gebildet<br />
oder geerbt und erzielt beträchtliche Vermögenseinkünfte.<br />
Immer mehr Versicherte verrin-<br />
gern freiwillig ihre Arbeitszeit. <strong>Die</strong> Versicherten<br />
sind viel flexibler geworden, und sie können zumindest<br />
teilweise ihre Aktivitäten von einer versicherungspflichtigen<br />
Beschäftigung auf andere<br />
Tätigkeiten verlagern.<br />
Versicherungsbeiträge wirken im geltenden<br />
System wie eine Steuer auf abhängige Beschäftigung.<br />
<strong>Die</strong> Aufnahme einer versicherungspflichtigen<br />
Tätigkeit wird unnötig erschwert. Mit jeder<br />
Erhöhung des Beitragssatzes wird der Übergang<br />
von der Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung<br />
weiter erschwert.<br />
<strong>Die</strong> Optionsregelung für Personen, deren<br />
Lohneinkommen die Versicherungspflichtgrenze<br />
übersteigt, ist mit den Umverteilungszielen nicht<br />
in Einklang zu bringen, und sie ist nicht auf das<br />
Familieneinkommen bezogen. So kann beispielsweise<br />
ein Ehepaar die Option ausüben,<br />
wenn ein Partner Alleinverdiener ist und dessen<br />
Lohn oberhalb der Grenze liegt. Sind dagegen<br />
beide Ehepartner beschäftigt und liegen die jeweiligen<br />
Löhne knapp unterhalb der Grenze,<br />
können sie die Option nicht ausüben, obwohl<br />
das Gesamteinkommen erheblich höher sein<br />
mag als bei dem Alleinverdiener-Ehepaar.<br />
An der Umverteilung müssen sich nicht nur<br />
die Pflichtversicherten beteiligen, sondern alle<br />
Steuerzahler, soweit die Kosten des Gesundheitswesens<br />
über die Finanzierung der Krankenhäuser<br />
von den Ländern getragen werden. Einkommensschwache<br />
Personen, die nicht in der<br />
gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind,<br />
werden ebenfalls von allen Steuerzahlern unterstützt.<br />
Einer der gravierendsten Nachteile der Umverteilung<br />
mit Hilfe von Beiträgen, die vom<br />
Arbeitseinkommen abhängen, liegt in dem Verzicht<br />
auf risikoäquivalente Prämien. <strong>Die</strong> lohnabhängige<br />
Prämie steht nicht im Einklang mit<br />
den zu erwartenden Aufwendungen der Krankenversicherung<br />
für die versicherte Person. Dadurch<br />
kommt es zu dem Verhalten der Versicherungen,<br />
Personen mit hohem Gesundheitsrisiko<br />
zu meiden oder umgekehrt, sich besonders<br />
um „gute Risiken“ zu bemühen, und es<br />
kann kein wirksamer Wettbewerb zwischen den<br />
Krankenkassen entstehen. Der Risikostrukturausgleich<br />
ist eine unzureichende und zum Teil<br />
in die falsche Richtung zielende Hilfskonstruktion,<br />
die einen echten Wettbewerb nicht ersetzen<br />
kann.