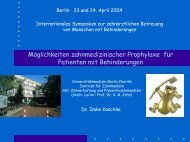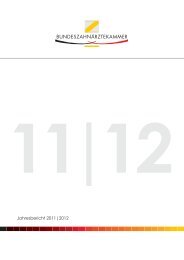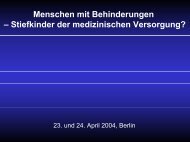Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Festschrift "50 Jahre Bundeszahnärztekammer 1953 - 2003" - Die ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zinsen und Mieten, generell in die Beitragsbemessung<br />
einbezieht, trägt der gegenüber der<br />
Nachkriegszeit veränderten Einkommens- und<br />
Vermögenssituation der Versicherten Rechnung.<br />
<strong>Die</strong> Reformoption im Rahmen der beitragsfreien<br />
Mitversicherung sieht für Ehepartner ein<br />
Splitting des gemeinsamen Arbeitsentgeltes bzw.<br />
Einkommens mit anschließender Anwendung<br />
des hälftigen Beitragssatzes auf beide Entgeltteile<br />
vor. Das Splittingverfahren entspricht insofern<br />
dem bisherigen Prinzip der Beitragsgestaltung,<br />
als es zu keiner zusätzlichen Belastung bei einer<br />
Familie führt, bei der das Arbeitsentgelt bzw.<br />
Einkommen des berufstätigen Partners unter der<br />
Beitragsbemessungsgrenze liegt.<br />
<strong>Die</strong>se beiden Reformoptionen weisen je<br />
nach Ausgestaltung ein Beitragssatzsenkungspotential<br />
zwischen 0,7 und 1,3 Beitragssatzpunkten<br />
auf. <strong>Die</strong> fiskalische Wirkung einer<br />
Verbreiterung der Beitragsbemessungsgrundlage,<br />
die bei maximal 0,4 Beitragssatzpunkten<br />
liegt, hängt vor allem davon ab, ob die übrigen<br />
Einkunftsarten dem vollen oder halben Beitragssatz<br />
unterliegen und ob die Empfänger von<br />
Zinsen in den Genuss eines Freibetrages oder<br />
einer Freigrenze kommen. Das Splittingverfahren,<br />
das eine Senkung der Beitragssätze um<br />
maximal 0,9 Prozentpunkte erlaubt, könnte<br />
zunächst den nicht-berufstätigen Partner, der<br />
Kinder erzieht bzw. erzogen hat und/oder häusliche<br />
Pflegedienste leistet, von der Beitragsbelastung<br />
freistellen. Der fiskalische Ertrag dieser<br />
Reformoption nimmt weiter ab, wenn für die<br />
Versicherten hier die Option besteht, zwischen<br />
dem Splittingverfahren und der Zahlung eines<br />
Mindestbeitrages für den nicht-berufstätigen<br />
Partner zu wählen.<br />
Darüber hinaus befürwortet eine Minderheit<br />
des Sachverständigenrates noch eine Erhöhung<br />
der Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze<br />
in der GKV auf das Niveau der<br />
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung (GRV), d.h. auf z. Zt. (2003)<br />
monatlich 5.100 €. <strong>Die</strong>se Reformoption erlaubt<br />
eine Beitragssatzsenkung um etwa 0,7 – mittelfristig<br />
0,9 – Beitragssatzpunkte. Eine kombinierte<br />
Erhöhung dieser beiden Grenzen belastet allerdings<br />
gerade jene Versicherten zusätzlich, die<br />
mit einem monatlichen Arbeitsentgelt zwischen<br />
3.340 € und 5.100 € bereits einer sehr hohen<br />
Grenzabgabenbelastung unterliegen. Für diese<br />
Versichertengruppe wirkt diese Zusatzbelastung<br />
wie eine Steuer, da ihr mit Ausnahme des<br />
Krankengeldes keine Mehrleistungen gegenüberstehen.<br />
Perspektivem einer Reform des Gesundheitswesens<br />
6. Adaptive Reformen als Voraussetzung<br />
einer Stabilisierung des Systems<br />
<strong>Die</strong> diskutierten Handlungsoptionen stellen<br />
überwiegend keine konkurrierenden Alternativen,<br />
sondern sich ergänzende Reformmaßnahmen<br />
dar. Eine Kombination dieser Optionen<br />
bietet sich vor allem an, wenn hohe Budgetdefizite<br />
drohen oder die Politik eine deutliche<br />
Senkung der Beitragssätze anstrebt. Ein kombinierter<br />
Einsatz unterschiedlicher Reformelemente<br />
besitzt zudem die Möglichkeit bzw. den<br />
Vorzug, allfällige Belastungen gleichmäßiger zu<br />
verteilen. So fällt z.B. eine Verbreiterung der<br />
Beitragsbemessungsgrundlage und/oder eine<br />
Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung<br />
für die Betroffenen weniger ins Gewicht,<br />
wenn gleichzeitig die Beitragssätze spürbar sinken.<br />
<strong>Die</strong> vorgestellten Reformschritte<br />
- Revision der Politik der<br />
„Verschiebebahnhöfe“,<br />
-Verlagerung krankenversicherungsfremder<br />
Leistungen auf andere Ausgabenträger,<br />
- Einengung des Leistungskatalogs,<br />
- Ausweitung der Selbstbeteiligung und<br />
- Änderung der Beitragsgestaltung<br />
beinhalten insgesamt ein Beitragssatzsenkungspotential<br />
in der GKV (Sozialversicherung)<br />
von ca. 4 (3,5) Prozentpunkten.<br />
Dabei bleiben die fiskalischen<br />
Effekte einer Einengung des Leistungskataloges,<br />
einer Ausweitung der Selbstbeteiligung<br />
und eventueller Effizienzsteigerungen<br />
noch unberücksichtigt.<br />
<strong>Die</strong> Umsetzung eines derartigen Reformspektrums<br />
würde wahrscheinlich – zumindest<br />
für absehbare Zeit – den Ruf nach einem Übergang<br />
zu alternativen Gesundheitssystemen verstummen<br />
lassen. <strong>Die</strong>s gilt um so mehr, als sich,<br />
wie internationale Erfahrungen zeigen, auch<br />
diese Systeme mit fiskalischen und Effizienzproblemen<br />
konfrontiert sehen. <strong>Die</strong> Abneigung<br />
gegenüber adaptiven Reformschritten entspringt<br />
häufig einer isolierten Betrachtungsweise, die<br />
nur die Vor- und Nachteile einer Handlungsoption<br />
gewichtet und die relevanten Alternativen<br />
vernachlässigt. Für sich betrachtet bilden weder<br />
eine Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung<br />
noch eine Einengung des Leistungskataloges<br />
oder eine Ausweitung der Selbstbeteiligung<br />
attraktive sozialpolitische Reformmaßnahmen.<br />
<strong>Die</strong> relevanten Alternativen bestehen<br />
aber nicht in dem Unterlassen dieser Optionen<br />
ort<br />
83 |<br />
Grußsw