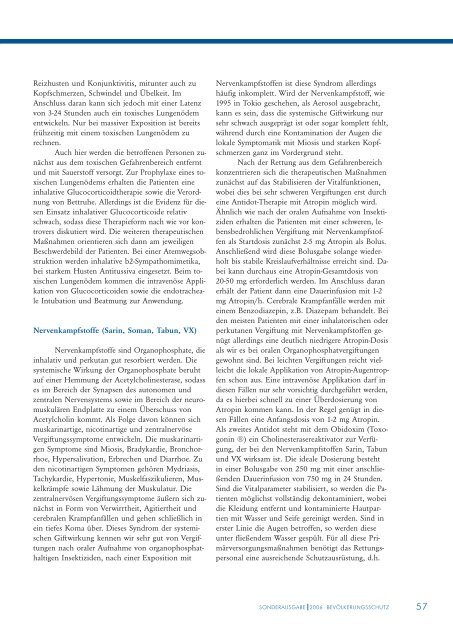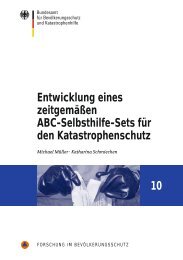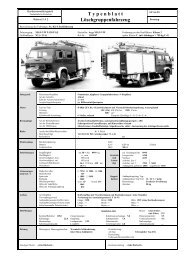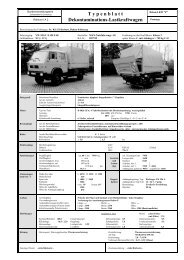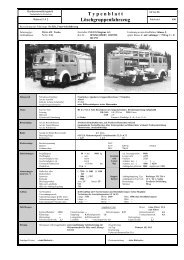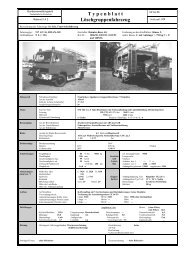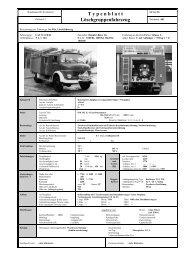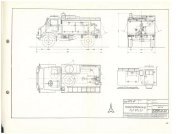Sonderausgabe: Dekontamination Verletzter (PDF, 2MB)
Sonderausgabe: Dekontamination Verletzter (PDF, 2MB)
Sonderausgabe: Dekontamination Verletzter (PDF, 2MB)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reizhusten und Konjunktivitis, mitunter auch zu<br />
Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Im<br />
Anschluss daran kann sich jedoch mit einer Latenz<br />
von 3-24 Stunden auch ein toxisches Lungenödem<br />
entwickeln. Nur bei massiver Exposition ist bereits<br />
frühzeitig mit einem toxischen Lungenödem zu<br />
rechnen.<br />
Auch hier werden die betroffenen Personen zunächst<br />
aus dem toxischen Gefahrenbereich entfernt<br />
und mit Sauerstoff versorgt. Zur Prophylaxe eines toxischen<br />
Lungenödems erhalten die Patienten eine<br />
inhalative Glucocorticoidtherapie sowie die Verordnung<br />
von Bettruhe. Allerdings ist die Evidenz für diesen<br />
Einsatz inhalativer Glucocorticoide relativ<br />
schwach, sodass diese Therapieform nach wie vor kontrovers<br />
diskutiert wird. Die weiteren therapeutischen<br />
Maßnahmen orientieren sich dann am jeweiligen<br />
Beschwerdebild der Patienten. Bei einer Atemwegsobstruktion<br />
werden inhalative b2-Sympathomimetika,<br />
bei starkem Husten Antitussiva eingesetzt. Beim toxischen<br />
Lungenödem kommen die intravenöse Applikation<br />
von Glucocorticoiden sowie die endotracheale<br />
Intubation und Beatmung zur Anwendung.<br />
Nervenkampfstoffe (Sarin, Soman, Tabun, VX)<br />
Nervenkampfstoffe sind Organophosphate, die<br />
inhalativ und perkutan gut resorbiert werden. Die<br />
systemische Wirkung der Organophosphate beruht<br />
auf einer Hemmung der Acetylcholinesterase, sodass<br />
es im Bereich der Synapsen des autonomen und<br />
zentralen Nervensystems sowie im Bereich der neuromuskulären<br />
Endplatte zu einem Überschuss von<br />
Acetylcholin kommt. Als Folge davon können sich<br />
muskarinartige, nicotinartige und zentralnervöse<br />
Vergiftungssymptome entwickeln. Die muskarinartigen<br />
Symptome sind Miosis, Bradykardie, Bronchorrhoe,<br />
Hypersalivation, Erbrechen und Diarrhoe. Zu<br />
den nicotinartigen Symptomen gehören Mydriasis,<br />
Tachykardie, Hypertonie, Muskelfaszikulieren, Muskelkrämpfe<br />
sowie Lähmung der Muskulatur. Die<br />
zentralnervösen Vergiftungssymptome äußern sich zunächst<br />
in Form von Verwirrtheit, Agitiertheit und<br />
cerebralen Krampfanfällen und gehen schließlich in<br />
ein tiefes Koma über. Dieses Syndrom der systemischen<br />
Giftwirkung kennen wir sehr gut von Vergiftungen<br />
nach oraler Aufnahme von organophosphathaltigen<br />
Insektiziden, nach einer Exposition mit<br />
Nervenkampfstoffen ist diese Syndrom allerdings<br />
häufig inkomplett. Wird der Nervenkampfstoff, wie<br />
1995 in Tokio geschehen, als Aerosol ausgebracht,<br />
kann es sein, dass die systemische Giftwirkung nur<br />
sehr schwach ausgeprägt ist oder sogar komplett fehlt,<br />
während durch eine Kontamination der Augen die<br />
lokale Symptomatik mit Miosis und starken Kopfschmerzen<br />
ganz im Vordergrund steht.<br />
Nach der Rettung aus dem Gefahrenbereich<br />
konzentrieren sich die therapeutischen Maßnahmen<br />
zunächst auf das Stabilisieren der Vitalfunktionen,<br />
wobei dies bei sehr schweren Vergiftungen erst durch<br />
eine Antidot-Therapie mit Atropin möglich wird.<br />
Ähnlich wie nach der oralen Aufnahme von Insektiziden<br />
erhalten die Patienten mit einer schweren, lebensbedrohlichen<br />
Vergiftung mit Nervenkampfstoffen<br />
als Startdosis zunächst 2-5 mg Atropin als Bolus.<br />
Anschließend wird diese Bolusgabe solange wiederholt<br />
bis stabile Kreislaufverhältnisse erreicht sind. Dabei<br />
kann durchaus eine Atropin-Gesamtdosis von<br />
20-50 mg erforderlich werden. Im Anschluss daran<br />
erhält der Patient dann eine Dauerinfusion mit 1-2<br />
mg Atropin/h. Cerebrale Krampfanfälle werden mit<br />
einem Benzodiazepin, z.B. Diazepam behandelt. Bei<br />
den meisten Patienten mit einer inhalatorischen oder<br />
perkutanen Vergiftung mit Nervenkampfstoffen genügt<br />
allerdings eine deutlich niedrigere Atropin-Dosis<br />
als wir es bei oralen Organophosphatvergiftungen<br />
gewohnt sind. Bei leichten Vergiftungen reicht vielleicht<br />
die lokale Applikation von Atropin-Augentropfen<br />
schon aus. Eine intravenöse Applikation darf in<br />
diesen Fällen nur sehr vorsichtig durchgeführt werden,<br />
da es hierbei schnell zu einer Überdosierung von<br />
Atropin kommen kann. In der Regel genügt in diesen<br />
Fällen eine Anfangsdosis von 1-2 mg Atropin.<br />
Als zweites Antidot steht mit dem Obidoxim (Toxogonin<br />
®) ein Cholinesterasereaktivator zur Verfügung,<br />
der bei den Nervenkampfstoffen Sarin, Tabun<br />
und VX wirksam ist. Die ideale Dosierung besteht<br />
in einer Bolusgabe von 250 mg mit einer anschließenden<br />
Dauerinfusion von 750 mg in 24 Stunden.<br />
Sind die Vitalparameter stabilisiert, so werden die Patienten<br />
möglichst vollständig dekontaminiert, wobei<br />
die Kleidung entfernt und kontaminierte Hautpartien<br />
mit Wasser und Seife gereinigt werden. Sind in<br />
erster Linie die Augen betroffen, so werden diese<br />
unter fließendem Wasser gespült. Für all diese Primärversorgungsmaßnahmen<br />
benötigt das Rettungspersonal<br />
eine ausreichende Schutzausrüstung, d.h.<br />
SONDERAUSGABE 2006 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ<br />
57