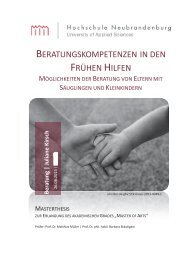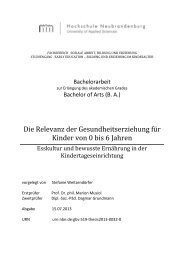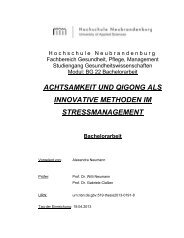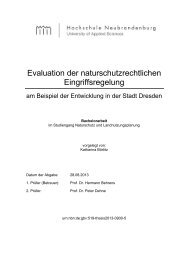WENN MAMA UND PAPA ANDERS SIND
WENN MAMA UND PAPA ANDERS SIND
WENN MAMA UND PAPA ANDERS SIND
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung<br />
hinderung von den negativen Reaktionen der Umgebung geprägt waren. Der Großteil der<br />
Eltern freute sich auf das Kind und war in der Lage, eine positive Beziehung zu diesem<br />
aufzubauen. Ebenso wurde eine breite Palette üblicher elterlicher Verhaltensweisen offensichtlich.<br />
Es wurden keine universellen behinderungsspezifischen Probleme im Zusammenhang<br />
von geistiger Behinderung und Elternschaft festgestellt. Außerdem kristallisierte<br />
sich mehr als deutlich heraus, dass Eltern mit geistiger Behinderung die am stärksten kontrollierte<br />
Gruppe der Gesellschaft war und immer noch ist und hier bisweilen höhere Maßstäbe<br />
gesetzt werden als an andere Eltern. Außerdem zeigte sich, dass das vollstationäre<br />
Unterstützungsangebot in Gegenüberstellung zum ambulanten überwog.<br />
2005 wurde eine Nachfolgestudie (vgl. Pixa-Kettner 2007b) erhoben. Insgesamt wurden<br />
von den Einrichtungen 1584 Fälle von Elternschaften mit geistiger Behinderung mit 2199<br />
Kindern genannt. Hier wurde im Vergleich zum Jahr 1993 ein Trend der Zunahme von<br />
Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung beobachtet, wobei diese dennoch<br />
eher als Ausnahme gelten. Außerdem ist ein großer Unterstützungsmangel zu verzeichnen,<br />
wobei regionale Unterschiede mitunter eine Rolle spielen. Die Unterstützung ist meist auf<br />
jüngere Kinder angelegt<br />
Insofern widmen sich heutige Studien der unterstützenden Wirkung und heben vorhandene<br />
und zu erlernende Kompetenzen und Ressourcen der Eltern hervor (vgl. Prangenberg 2008,<br />
S. 45). Die Studien zeigen, dass Menschen mit geistiger Behinderung trotz eigener belastender<br />
Sozialisationserfahrungen und schwieriger Umfeldbedingungen hinreichend gute<br />
Eltern sein können. Sie sind in der Lage, sowohl elterliche Qualifikationen mit in die Elternschaft<br />
zu bringen als auch neue zu erlernen.<br />
Mit einem Blick auf die Kinder wird darüber diskutiert, ob die Ergebnisse in Hinblick auf<br />
die elterlichen Kompetenzen ausreichend sind, um dem Kindeswohl gerecht zu werden.<br />
Genügen diese Annahmen, obwohl man davon ausgeht, dass die Entwicklungsbedingungen<br />
der Kinder vermutlich weniger optimal verlaufen werden? Sind die Eltern den sich<br />
ständig verändernden Erziehungsanforderungen gewachsen? Die befürchtete Kindeswohlgefährdung<br />
ist der zentrale Einwand gegen ein Recht auf Elternschaft von geistig behinderten<br />
Menschen (vgl. Sanders 2007, S. 90; vgl. Wohlgensinger 2008, S. 13). Diese Auseinandersetzung<br />
ist vor allem in der polarisierenden Fachdiskussion zu erkennen, im Umgang<br />
mit dem Kinderwunsch geistig behinderter Menschen und in Verbindung mit rechtlich<br />
relevanten Fragen (vgl. Vlasak 2008). Darüber hinaus wird über Zusammenhänge zwi-<br />
13