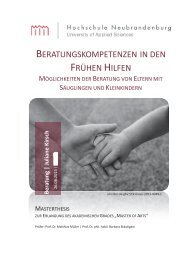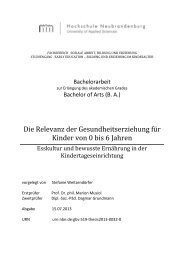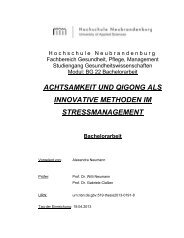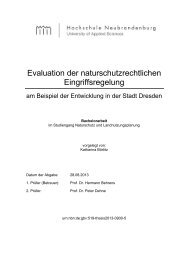WENN MAMA UND PAPA ANDERS SIND
WENN MAMA UND PAPA ANDERS SIND
WENN MAMA UND PAPA ANDERS SIND
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Risiko- und Schutzfaktoren im Leben der Kinder von Eltern mit geistiger Behinderung<br />
Gleichzeitig sollte danach gefragt werden, ob eine Rollenumkehr ebenfalls Chancen für die<br />
kindliche Entwicklung mit sich bringen kann (vgl. Sanders 2008, S. 170). Es ist anzunehmen,<br />
dass einige Kinder durch die Übernahme „erwachsenentypischer“ Aufgaben über ein<br />
hohes Maß an Selbstverantwortlichkeit verfügen und demzufolge mehr Vertrauen in ihre<br />
Handlungskompetenzen haben. Parentifizierung kann daher ebenfalls als Umverteilung der<br />
familiären Aufgaben verstanden werden und weniger als Umkehr der Identität. Die Rollen<br />
der Familienmitglieder bleiben somit bestehen (vgl. Sanders 2008, S. 170).<br />
Diskriminierung und Tabuisierung der elterlichen Behinderung<br />
Gesellschaftliche Abwertungs- und Ausgrenzungsprozesse gegenüber Menschen mit Behinderungen<br />
sind nicht nur als eine hohe Belastung für die Eltern zu verstehen, sondern<br />
ebenfalls für deren Kinder (vgl. Sanders 2008, S. 170). Diese Belastung zieht sich meist<br />
durch den gesamten Lebensverlauf. In den biografischen Interviews von Prangenberg (vgl.<br />
2002) reflektieren erwachsene Kinder mit geistig behinderten Eltern auf der persönlichen<br />
Ebene Stigmatisierungen und Diskriminierungen. Diese zeigten sich überwiegend darin,<br />
dass die betreffenden Kinder in der Schule oder in der Nachbarschaft beschimpft, gehänselt,<br />
ungerecht behandelt und abgewertet wurden. Auf der institutionellen Ebene (vgl. Sanders<br />
2008, S. 171) wurden beispielsweise Anliegen in Behörden zum Teil nicht ernst genommen.<br />
Jene erwachsenen Kinder reflektierten, dass sie häufig Intoleranz wahrnahmen.<br />
Ihnen wurde oft unterstellt, dass sie als Nachkommen von Sonderschülern ohnehin nicht in<br />
der Lage wären, Aufgaben zu bewältigen. Ebenfalls zeigte sich, dass betroffene Kinder auf<br />
der ökonomischen Ebene (vgl. Sanders 2008, S. 171) gesellschaftlich ausgeschlossen wurden,<br />
da Menschen mit einer geistigen Behinderung meist sozioökonomisch benachteiligt<br />
und durch entsprechende Folgeerscheinungen geprägt sind (vgl. Prangenberg 2002, S. 59).<br />
Selbst als Erwachsene werden Kinder geistig behinderter Eltern mit Vorurteilen konfrontiert.<br />
Nicht nur ihre Eltern werden abgewertet, sondern sie selbst werden als etwas „Besonderes“<br />
etikettiert (vgl. Sanders 2008, S. 171). Die gesellschaftliche Tabuisierung der elterlichen<br />
Behinderung schränkt die Kinder im sozialen Kontakt ein. Sie sind unsicher, wie sie<br />
die Behinderung ihrer Eltern anderen gegenüber thematisieren sollen. Daher unterliegen<br />
sie einem Spannungsfeld zwischen Ablehnung und Anerkennung. Beide Reaktionen bedingen<br />
jedoch, dass andere Menschen distanziert bleiben, ohne Interesse an den tatsächlichen<br />
Erfahrungen zu zeigen (vgl. Sanders 2008, S. 171f).<br />
35