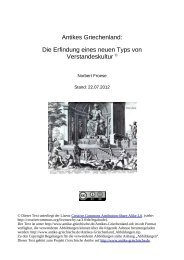Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sich die Geometrie beschäftigt, ist aber ausdehnungslos. Jede Linie, die wir zeichnen<br />
besitzt eine, wenn auch minimale, Breite. Die Linie der Geometrie besitzt aber keine, nicht<br />
einmal eine minimale Breite. Jeder Kreis den wir zeichnen ist nicht ganz perfekt. In<br />
entsprechender Vergrößerung werden dessen Unrundheiten sichtbar. Der Kreis der<br />
Geometrie ist aber vollkommen. Wenn ich mit einem Stift ein Dreieck skizziere, so hat das<br />
Dreieck eine bestimmte Farbe (eben die des gewählten Stifts). Die Dreiecke der<br />
Geometrie aber besitzen keine Farbe.<br />
Wir kennen also genau genommen die Gegenstände der Geometrie nicht aus unserer<br />
Erfahrungswelt, sondern nur aus unserem Denken. Die sinnlichen Eindrücke unserer<br />
Erfahrungswelt sind uns zwar in mancherlei Hinsicht hilfreich beim Aufbau unserer<br />
geometrischen Vorstellungswelt, aber nie hat jemand eine Linie ohne Breite gesehen. Die<br />
Gegenstände der Geometrie sind eben ideale Objekte, zu denen wir nur mittels des<br />
Gebrauchs unserer Vernunft Zugang haben.<br />
Zu solchen idealen Objekten können wir, ein wenig Begabung vorausgesetzt, mit mehr<br />
oder minder großer Mühe mathematische Sätze beweisen. Und diese Sätze haben dann<br />
auch noch Anspruch auf ewige Geltung. Irgendwie ist das in der Tat verblüffend.<br />
<strong>Platon</strong> (genauer die Figur des platonischen SOKRATES) deutet nun unser Talent zur<br />
geometrischen Einsicht als Wiedererinnern an das, was unsere unsterbliche Seele<br />
vorgeburtlich gewusst (geschaut) hat (vgl. den Dialog Menon). Mit dieser (Um-)Deutung<br />
des Wissens ist ein wichtiger Grundstein für die Ideenlehre gelegt.<br />
<strong>Platon</strong> scheint sich zu fragen, warum es uns nicht auch jenseits der <strong>Mathematik</strong> möglich<br />
sein soll, sich von den sinnlichen Erfahrungen abzulösen, um dann in rein gedanklicher<br />
Arbeit die wirklich fundamentalen idealen Objekte (nämlich den Ideen) zu erinnern?<br />
Um zur Ideenlehre zu gelangen fehlen zwar noch ein paar wichtige Bausteine, aber ein<br />
gutes Stück der Wegstrecke zur Formulierung der Ideenlehre hat man bereits hinter sich,<br />
wenn man die Arbeitsweise der Geometrie zum prototypischen Vorbild jedweden Strebens<br />
nach Erkenntnis erklärt. Echtes Wissen erwirbt man nur - das ist ein zentraler Gedanke<br />
der Ideenlehre – indem man seine Vernunft gebraucht, statt sich auf seine Sinne zu<br />
verlassen.<br />
In einer Zeit, in der es eben die beweisende <strong>Mathematik</strong>, und insbesondere die<br />
Geometrie, ist, die die faszinierendsten Fortschritte erzielt, ist eine solche Einstellung<br />
durchaus naheliegend. Das gilt natürlich um so mehr, wenn, wie bei <strong>Platon</strong>, einer<br />
Beschäftigung mit den Gegenständen unserer sinnlichen Erfahrung von vornherein jede<br />
Aussicht auf die Gewinnung von echtem Wissen bestritten wird. Für den Heraklit<br />
Anhänger <strong>Platon</strong> wird die <strong>Mathematik</strong> (und insbesondere ihr Paradepferd Geometrie) so<br />
praktisch automatisch zum wichtigsten Orientierungspunkt für die Suche nach neuen<br />
Pfaden der Erkenntnis.<br />
Die <strong>Mathematik</strong> ist nicht nur das Vorbild für <strong>Platon</strong>s Konzept von Erkenntnis. Auch <strong>Platon</strong>s<br />
beliebteste Argumentationsmethode hat ein Vorbild in der <strong>Mathematik</strong>: den indirekten<br />
Beweis.<br />
Die Wahrheit, das sind die Ideen. Die Ideen sind das wahrhaft Seiende, nicht<br />
die mit den Sinnen wahrnehmbaren Dinge. Man kann die Ideen erblicken,<br />
manchmal, in begnadeten Augenblicken, durch die Erinnerung an die Zeit, als<br />
die Seele bei Gott im Reich der Wahrheit weilte; aber erst muss man durch<br />
angestrengtes Denken den Wahn der Sinne überwunden haben. Der Weg dazu<br />
ist die Dialektik und das Beweismittel der Dialektik ist der indirekte Beweis.<br />
Die Wahrheit kann nicht mit sich selbst im Widerspruch stehen. Findet man<br />
also, ausgehend von einer bestimmten vorläufigen Hypothese, einen<br />
Widerspruch, so muss die Hypothese verworfen werden. (...)<br />
-17-