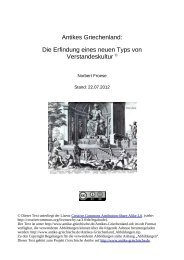Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
spezifisch nationale Vorlieben zu geben. In der <strong>Platon</strong> Community ist es auf jeden Fall<br />
bisher nicht gelungen so etwas wie den eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren<br />
Arguments (Habermas) zu etablieren.<br />
Es wird hier weder versucht, diese Probleme vor dem Leser zu verbergen, noch wird versucht,<br />
die bekannten, hoch diffizilen Probleme durch eigene Beiträge zu lösen. Aber es ist<br />
auch unmöglich ein <strong>Platon</strong> Papier zu verfassen, ohne <strong>Platon</strong> dabei zu interpretieren.<br />
Allerdings werden (nach Möglichkeit) jene Stellen gemieden, die dazu zwingen würden,<br />
sich am Spiel des Aufsuchens verborgener Bedeutungsebenen oder am Einsatz ähnlich<br />
riskanter Interpretationstechniken zu beteiligen. Ich werde mir jedoch die Freiheit nehmen,<br />
das, was ich für dunkel halte, auch dunkel zu nennen. Gemeinhin wird in der <strong>Platon</strong><br />
Literatur in solchen Fällen die Sprechweise „komplizierte Stelle“ bevorzugt.<br />
Im Anschluss an die Darstellung der Ideenlehre wird die Frage aufgeworfen, ob <strong>Platon</strong> ein<br />
Anhänger der Ideenlehre war. Diese Frage wird dem Neuling in der Welt der <strong>Platon</strong><br />
Dialoge zunächst etwas absurd erscheinen. Nun, die Frage ist nicht ganz so absurd, wie<br />
es auf den ersten Blick scheint. Es gibt einen berühmten siebenten Brief von <strong>Platon</strong><br />
(Echtheit allerdings umstritten), indem <strong>Platon</strong> erklärt, dass er seine philosophischen<br />
Überzeugungen nirgends schriftlich niedergelegt hat. Wenn der Brief echt ist, dann stammt<br />
er aus den letzten Lebensjahren <strong>Platon</strong>s. Das, was heute als sein Hauptwerk gilt, der<br />
Dialog Der Staat, war da längst geschrieben. Hat also <strong>Platon</strong> dieses Werk überhaupt nicht<br />
mit der Absicht verfasst dem Leser Einblick in die Welt seines Denkens zu geben? Wir<br />
werden auf diese Frage zu sprechen kommen.<br />
Zum Ende werden die dunklen Seiten <strong>Platon</strong>s, seine Staatsutopien, ganz ausdrücklich<br />
Thema. Die Kernthese Poppers wird vorgestellt und durch eine Auswahl an Zitaten aus<br />
<strong>Platon</strong>s Dialogen gestützt. Auch hier wird aber keine auch nur annähernd vollständige<br />
Aufarbeitung angestrebt. Die dort aufgeführten Beispiele zu den erschreckenden Seiten<br />
<strong>Platon</strong>s politischer Visionen werden aber hoffentlich ausreichen, um den Leser vor naiver<br />
<strong>Platon</strong> Verehrung zu bewahren.<br />
Viele der Themen, die <strong>Platon</strong> in seinen Dialogen behandelte, werden hier nicht einmal am<br />
Rande berührt. Insbesondere seine Beiträge zur Naturphilosophie und wesentliche<br />
Aspekte der Sprachphilosophie bleiben ausgespart. Ich hätte sogar die Thematik gern<br />
noch weiter eingegrenzt, aber alle Versuche das Papier stärker zu kürzen und thematisch<br />
noch engherziger auszulegen, haben keine guten Ergebnisse gezeitigt.<br />
Der Philosoph <strong>Platon</strong> war deutlich von der <strong>Mathematik</strong> fasziniert und diese Faszination hat<br />
seine <strong>Philosophie</strong> spürbar geprägt. Ich versuche deswegen, dem Leser den Zugang zur<br />
Ideenlehre durch eine Darstellung der mathematischen Interessen <strong>Platon</strong>s zu erleichtern.<br />
Die <strong>Mathematik</strong> begeisterte Seite <strong>Platon</strong>s wird für meinen Geschmack in vielen modernen<br />
Einführungen zu <strong>Platon</strong> zu sehr vernachlässigt.<br />
Noch ein Hinweis: Um terminologische Probleme zu vermeiden, habe ich mich dazu<br />
entschlossen in diesem Papier schon sehr früh zwischen <strong>Platon</strong> und der von ihm<br />
benutzten Dialog Figur SOKRATES zu unterscheiden. Dies ermöglicht es (bei Bedarf) der<br />
Frage, ob <strong>Platon</strong> sich an einer gegebenen Stelle mit seiner Figur SOKRATES identifiziert, aus<br />
dem Weg zu gehen. Das führt allerdings auch zu der Sprechweise, dass der platonische<br />
SOKRATES der Verkünder der Ideenlehre ist. Natürlich ist aber dieser platonische SOKRATES<br />
eine literarische Erfindung <strong>Platon</strong>s und besitzt streng genommen keine eigenen<br />
Überzeugungen. Ich behandle diese Figur wie eine Romanfigur oder Gestalt eines<br />
Dramas. Wenn mit Bezug auf die Figur SOKRATES von Meinungen, Behauptungen oder<br />
ähnlichem gesprochen wird, dann ist das analog zu einer Charakterisierung der Figur<br />
Wallensteins zu verstehen. Die Aufgabe der Ausdeutung dieser Figur aus Schillers<br />
gleichnamiger Dramen-Trilogie hat wohl beinahe jeder im Deutschunterricht bearbeitet.<br />
Für den generell von mir angestrebten Typ eines Einführungspapier ist dieses hier<br />
eigentlich zu lang. Aber irgendwie ging es nicht kürzer.<br />
-7-