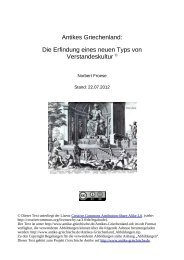Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
War <strong>Platon</strong> ein Anhänger der Ideenlehre?<br />
<strong>Platon</strong> schützt sich auf mannigfache Weise davor, dass ihm die in seinen Dialogen<br />
vorgetragenen Meinungen, Thesen, Argumente als persönliche Überzeugungen zugerechnet<br />
werden können.<br />
1. <strong>Platon</strong> benutzt den platonischen SOKRATES als Zentralfigur der meisten seiner<br />
Dialoge. Eine Figur PLATON tritt nirgends auf. (Wozu diese Distanzierung vom Inhalt<br />
der Dialoge?)<br />
2. <strong>Platon</strong> lässt den platonischen SOKRATES gerade an zentralen Stellen beinahe<br />
routinemäßig Vorbehalte gegenüber dem Vorgetragenen einflechten.<br />
3. Im Dialog Phaidros (ein Dialog der Gruppe 2) lässt <strong>Platon</strong> erhebliche und<br />
prinzipielle Bedenken gegen die schriftliche Niederlegung philosophischer<br />
Gedanken vortragen.<br />
Sehen wir uns zumindest eine der einschlägigen Stellen aus dem Phaidros kurz an:<br />
SOKRATES: Also wer meint , in schriftlicher Aufzeichnung eine Kunstanweisung<br />
zu hinterlassen und andererseits wer solche annimmt in dem Glauben, es<br />
könne etwas Deutliches und Sicheres aus schriftlichen Aufzeichnungen<br />
entnommen werden, dürfte mit großer Einfalt behaftet sein und wirklich die<br />
Weissagung Ammons nicht kennen, indem er geschriebenen Worten keine<br />
weiter gehende Bedeutung beilegt, als die, Wissenden zur Erinnerung zu<br />
dienen an die Dinge, worüber die Aufzeichnungen handeln.<br />
PHAIDROS: Ganz richtig.<br />
SOKRATES: Denn das ist wohl das Bedenkliche beim Schreiben und gemahnt<br />
wahrhaftig an die Malerei: auch die Werke jener Kunst stehen vor uns als<br />
lebten sie; doch fragst du sie etwas, so verharren sie in gar würdevollem<br />
Schweigen. Ebenso auch die Worte eines Aufsatzes: du möchtest glauben, sie<br />
sprechen und haben Vernunft; aber wenn du nach etwas fragst, was sie<br />
behaupten, um es zu verstehen, so zeigen sie immer nur ein und dasselbe an.<br />
Und dann: einmal niedergeschrieben, treibt sich jedes Wort allenthalben<br />
wahllos herum, in gleicher Weise bei denen, die es verstehen, wie auch genau<br />
so bei denen, die es nichts angeht, und weiß nicht zu sagen, zu wem es<br />
kommen sollte und zu wem nicht. Wenn es dann schlecht behandelt und<br />
ungerechterweise geschmäht wird, so bedarf es immer eines Vaters, der ihm<br />
helfen sollte: denn selbst kann es weder sich wehren noch sich helfen.<br />
PHAIDROS: Auch das ist vollkommen richtig. (Phaidros; St. 275) 121<br />
Bereits die drei oben angeführten Punkte begründen also erhebliche Zweifel, ob man das<br />
Destillat Ideenlehre berechtigter Weise mit <strong>Platon</strong>s philosophischen Überzeugungen<br />
identifizieren darf. Und dann gibt es da noch den siebenten Brief. Im siebenten Brief<br />
bestreitet <strong>Platon</strong> kurzer Hand, dass er seine <strong>Philosophie</strong> irgendwo schriftlich niedergelegt<br />
hat. Der Brief stammt aus den letzten Lebensjahren <strong>Platon</strong>s. Der Staat, wie die<br />
überwiegende Mehrzahl seiner sonstigen Dialoge, waren da schon vollendet. Wenn man<br />
den siebenten Brief beim Wort nimmt, dann enthalten all diese Dialoge alles Mögliche,<br />
aber nicht <strong>Platon</strong>s eigentliche <strong>Philosophie</strong>.<br />
Die Echtheit dieses Briefs ist jedoch umstritten. Es gibt allerdings keine sprachstatistischen<br />
oder sonstigen Hinweise darauf, dass es sich hierbei um eine Fälschung<br />
handelt. Falls es eine Fälschung ist, ist sie meisterhaft. Die einzigen Gründe, die für die<br />
These einer Fälschung ins Feld geführt werden können, beziehen sich auf die<br />
(angebliche) Unglaublichkeit des Inhalts. Man kann dies allerdings auch so deuten, dass<br />
es einigen Autoren einfach schwer fällt, zu glauben, dass die oben zitierten Ausführungen<br />
im Phaidros <strong>Platon</strong>s tatsächliche Einschätzung zur schriftlichen Niederlegung von<br />
121 <strong>Platon</strong>: Sämtliche Dialoge. Bd II. Übersetzt von Constantin Ritter. Hamburg: Meiner Verlag 1988. S. 104<br />
-67-