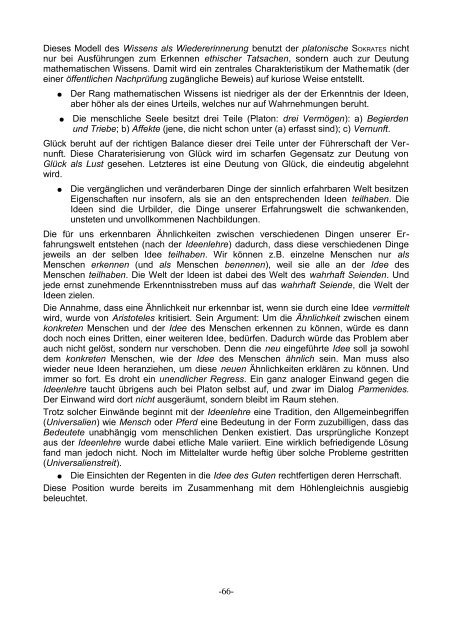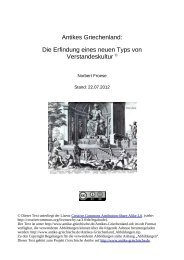Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dieses Modell des Wissens als Wiedererinnerung benutzt der platonische SOKRATES nicht<br />
nur bei Ausführungen zum Erkennen ethischer Tatsachen, sondern auch zur Deutung<br />
mathematischen Wissens. Damit wird ein zentrales Charakteristikum der <strong>Mathematik</strong> (der<br />
einer öffentlichen Nachprüfung zugängliche Beweis) auf kuriose Weise entstellt.<br />
● Der Rang mathematischen Wissens ist niedriger als der der Erkenntnis der Ideen,<br />
aber höher als der eines Urteils, welches nur auf Wahrnehmungen beruht.<br />
● Die menschliche Seele besitzt drei Teile (<strong>Platon</strong>: drei Vermögen): a) Begierden<br />
und Triebe; b) Affekte (jene, die nicht schon unter (a) erfasst sind); c) Vernunft.<br />
Glück beruht auf der richtigen Balance dieser drei Teile unter der Führerschaft der Vernunft.<br />
Diese Charaterisierung von Glück wird im scharfen Gegensatz zur Deutung von<br />
Glück als Lust gesehen. Letzteres ist eine Deutung von Glück, die eindeutig abgelehnt<br />
wird.<br />
● Die vergänglichen und veränderbaren Dinge der sinnlich erfahrbaren Welt besitzen<br />
Eigenschaften nur insofern, als sie an den entsprechenden Ideen teilhaben. Die<br />
Ideen sind die Urbilder, die Dinge unserer Erfahrungswelt die schwankenden,<br />
unsteten und unvollkommenen Nachbildungen.<br />
Die für uns erkennbaren Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Dingen unserer Erfahrungswelt<br />
entstehen (nach der Ideenlehre) dadurch, dass diese verschiedenen Dinge<br />
jeweils an der selben Idee teilhaben. Wir können z.B. einzelne Menschen nur als<br />
Menschen erkennen (und als Menschen benennen), weil sie alle an der Idee des<br />
Menschen teilhaben. Die Welt der Ideen ist dabei des Welt des wahrhaft Seienden. Und<br />
jede ernst zunehmende Erkenntnisstreben muss auf das wahrhaft Seiende, die Welt der<br />
Ideen zielen.<br />
Die Annahme, dass eine Ähnlichkeit nur erkennbar ist, wenn sie durch eine Idee vermittelt<br />
wird, wurde von Aristoteles kritisiert. Sein Argument: Um die Ähnlichkeit zwischen einem<br />
konkreten Menschen und der Idee des Menschen erkennen zu können, würde es dann<br />
doch noch eines Dritten, einer weiteren Idee, bedürfen. Dadurch würde das Problem aber<br />
auch nicht gelöst, sondern nur verschoben. Denn die neu eingeführte Idee soll ja sowohl<br />
dem konkreten Menschen, wie der Idee des Menschen ähnlich sein. Man muss also<br />
wieder neue Ideen heranziehen, um diese neuen Ähnlichkeiten erklären zu können. Und<br />
immer so fort. Es droht ein unendlicher Regress. Ein ganz analoger Einwand gegen die<br />
Ideenlehre taucht übrigens auch bei <strong>Platon</strong> selbst auf, und zwar im Dialog Parmenides.<br />
Der Einwand wird dort nicht ausgeräumt, sondern bleibt im Raum stehen.<br />
Trotz solcher Einwände beginnt mit der Ideenlehre eine Tradition, den Allgemeinbegriffen<br />
(Universalien) wie Mensch oder Pferd eine Bedeutung in der Form zuzubilligen, dass das<br />
Bedeutete unabhängig vom menschlichen Denken existiert. Das ursprüngliche Konzept<br />
aus der Ideenlehre wurde dabei etliche Male variiert. Eine wirklich befriedigende Lösung<br />
fand man jedoch nicht. Noch im Mittelalter wurde heftig über solche Probleme gestritten<br />
(Universalienstreit).<br />
● Die Einsichten der Regenten in die Idee des Guten rechtfertigen deren Herrschaft.<br />
Diese Position wurde bereits im Zusammenhang mit dem Höhlengleichnis ausgiebig<br />
beleuchtet.<br />
-66-