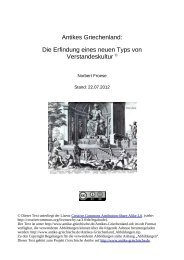Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
positives Ergebnis haben, Definitionsdialog knüpft daran an, dass es scheinbar jeweils<br />
um eine Definitionsfrage geht. Unter Bezug auf das Sokrates Bild in <strong>Platon</strong>s Dialogen gibt<br />
uns Monique Canto-Sperber folgende Erläuterung hierzu:<br />
So berühmt aber diese Bitte um eine Definition auch immer sein mag – sie<br />
wurde sogar bereits als „Was ist X?“-Frage bezeichnet –, sie bleibt trotz allem<br />
ziemlich unklar. Die Definition, um die Sokrates bittet, ist keine lexikalische<br />
Definition (welche die Synonyme eines Ausdrucks und die Bedingungen seines<br />
korrekten Gebrauchs angibt), sie ist auch keine kausale Definition, sondern<br />
eher eine Wesensdefinition, die ein reales Wesen aufzeigen soll, das über die<br />
gleiche Art von Sein verfügt wie die Einzelphänomene, denen es zugehört und<br />
die nach ihm benannt sind. Diese als eidos oder idea bezeichnete Eigenschaft<br />
ist höchstwahrscheinlich der Gegenstand jener „allgemeinen Definition“, als<br />
deren Erfinder Sokrates gilt, wie Aristoteles berichtet (Metaphysik). 63<br />
Das, was hier im Zitat Wesensdefinition genannt wird, liegt weit ab von dem, was man<br />
heutzutage in den Wissenschaften unter einer Definition versteht. 64 Das Konzept der<br />
Wesensdefinition zielt nicht einfach auf die Fixierung sprachlicher Konventionen, es wird<br />
vielmehr die Existenz einer vorgegebenen Entität angenommen, die erfasst werden soll.<br />
Wenn man z.B. Adjektive wie schön, gut, fromm substantiviert, dann bezeichnen diese<br />
Substantive (z.B. das Fromme) sicherlich keine Dinge der sinnlich erfahrbaren Welt, auf<br />
die man mit dem Finger zeigen könnte. Wenn nun von der Annahme ausgegangen wird,<br />
dass es ein Irgendetwas geben müsse, das durch diese substantivierten Adjektive<br />
bezeichnet wird, landet man bei immateriellen Entitäten (eidos oder idea). Die Aufgabe der<br />
Wesensdefinition ist es dann, die genaue Natur dieser Entitäten zu enthüllen. Auch abseits<br />
der Diskussion substantivierter Adjektive versprach man sich von der Enthüllung solch<br />
schwierig fassbarer Entitäten in etlichen Schulen der antiken griechischen <strong>Philosophie</strong><br />
große Erkenntnisgewinne (siehe z.B. auch die Wesensdefinitionen bei Aristoteles).<br />
In den hier herangezogenen Dialogen tritt das Abzielen auf eine (nicht aufgefundene)<br />
Wesensdefinition schon mit einiger Deutlichkeit hervor. Man kann dabei den Verdacht<br />
hegen, dass <strong>Platon</strong> schon sehr früh damit begonnen hat, Sokrates (mehr oder minder<br />
bewusst) eine größere Nähe zum Konzept der Wesensdefinition anzudichten, als dieser<br />
besaß. Das wird hier nicht weiter interessieren. Leser, die mit der Wesensdefinition bei<br />
Aristoteles vertraut sind, sollten die <strong>Platon</strong> Dialoge jedoch nicht zu sehr unter<br />
Heranziehung der aristotelischen Konzeption einer Wesensdefinition lesen. Es geht hier<br />
um einen Vorläufer dessen, was später bei Aristoteles eine Wesensdefinition ausmacht.<br />
Aber sicherlich richtig ist: Auch in den hier ausgewählten drei Dialogen strebt SOKRATES<br />
nach deutlich mehr als einer bloßen lexikalischen Definition, welche die Synonyme eines<br />
Ausdrucks und die Bedingungen seines korrekten Gebrauchs angibt. Er verfolgt die<br />
aufgeworfenen Was ist X?-Fragen, weil er an einer Grundlegung von Sittlichkeit und Moral<br />
interessiert ist. SOKRATES ist kein des <strong>Griechische</strong>n nur halbmächtiger, der darauf angewiesen<br />
ist, seine Mitbürger um Beistand durch Worterläuterungen (Definitionen) bitten zu<br />
können. Für SOKRATES sind Was ist X?-Fragen Mittel der <strong>Philosophie</strong>.<br />
Zur weitergehenden Erläuterung der Struktur der aporetischen Definitionsdialoge zieht<br />
man am besten ein Beispiel heran. Der <strong>Platon</strong> Dialog Euthyphron ist recht kurz und hat<br />
eine gut überschaubare Struktur. Er eignet sich, um aufzuzeigen, aus welchen Ansätzen<br />
heraus sich der spätere platonische SOKRATES entwickelt hat. Der Dialog Euthyphron<br />
gliedert sich in 20 Kapitel (Abschnitte). Bis zu Kapitel zwölf wird der Dialog relativ eng<br />
verfolgt. Den Rest des Dialogs kann man dann sehr knapp zusammen fassen. Ich mache<br />
von dieser Möglichkeit Gebrauch.<br />
63 Monique Canto-Sperber: Sokrates. In: Das Wissen der Griechen. Wilhelm Fink Verlag: München 2000. S. 693<br />
64 Zum Thema moderne Definitionstheorie sei Wilhelm K. Essler: Wissenschaftstheorie I - Definition und Reduktion,<br />
Alber: München 1982 empfohlen.<br />
-29-