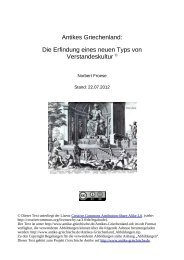Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
alles übrige verrichte. Und so scheint, alles kurz zusammengefaßt, deine Frage<br />
dahin beantwortet werden zu müssen, die Besonnenheit sei eine gewisse<br />
Bedächtigkeit. (Charmides; St. 158 – 159) 72<br />
Interessant an dieser Stelle ist, mit welcher Selbstverständlichkeit SOKRATES unterstellt,<br />
dass es ein Wesen der Besonnenheit gibt und und dass jemand, der Griechisch spricht<br />
(und sich selbst besonnen nennt) auch angeben können sollte, worin Besonnenheit<br />
besteht.<br />
SOKRATES lehnt in der Folge den Vorschlag Besonnenheit als Form von Bedächtigkeit<br />
aufzufassen ab. Er verweist (unter anderem) darauf, dass es Formen der Besonnenheit<br />
gibt, bei denen Bedächtigkeit keine Rolle spielt. 73<br />
Nach diesem gescheiterten Versuch, schlagen sowohl CHARMIDES wie KRITIAS weitere<br />
Charakterisierungen von Besonnenheit vor. KRITIAS findet dann schließlich eine<br />
Charakterisierung von Besonnenheit, die bei SOKRATES auf größeres Interesse stößt.<br />
Weitab vom üblichen Sprachgebrauch charakterisiert KRITIAS Besonnenheit als Erkennen<br />
seiner selbst und radikaler noch: als das Wissen um Wissen und Nichtwissen.<br />
Mein Urteil, sagte er (Kritias; NF), ist folgendes: sie (die Besonnenheit; NF) ist<br />
im Unterschied von allen anderen Arten des Wissens diejenige Art, welche<br />
sowohl über sich selbst wie über die anderen Wissensfächer Bescheid weiß.<br />
Wird sie nicht auch, fuhr ich fort, das Wissen der Unwissenheit sein, wenn<br />
anders sie das Wissen ist.<br />
Allerdings sagte er. (Charmides; St. 166) 74<br />
Auch diese Form der Definition wird am Ende des Dialogs verworfen. Der Gedankengang,<br />
der hierzu führt, ist allerdings verschlungen. Nach von SOKRATES forcierten, allgemeinen<br />
Erörterungen zum Thema Wissen und das Gute wird von SOKRATES festgestellt, dass der<br />
Definitionsvorschlag kein rechtes Verständnis des Nutzens der Besonnenheit ermöglicht<br />
und deswegen nicht akzeptiert werden kann.<br />
Siehst du nun, mein Kritias, daß meine schon längst vorhandene Furcht<br />
wohlbegründet war und daß ich mich mit Recht beschuldigte, meine<br />
Betrachtung über die Besonnenheit sei unfruchtbar? Denn schwerlich hätte<br />
sich uns dasjenige, was anerkanntermaßen das Allerherrlichste ist (die<br />
Besonnenheit; NF), als unnütz herausgestellt, wenn ich irgendwie tauglich<br />
wäre für eine fruchtbare Untersuchung. (Charmides; St. 175) 75<br />
Sehr salopp formuliert lautet das Ergebnis des Dialogs: Weil ohne Kenntnis des Guten<br />
alles andere nutzlos ist und der Definitionsvorschlag zur Besonnenheit darauf keinen<br />
Bezug nimmt, kann die so definierte Besonnenheit auch nicht nützlich sein. Da aber die<br />
Nützlichkeit der Besonnenheit allgemein akzeptiert ist, kann auch der zuletzt untersuchte<br />
Definitionsvorschlag nicht akzeptiert werden.<br />
Ergänzung zum sprachphilosophischen Einwand: Es gibt in der <strong>Platon</strong> Literatur den Begriff<br />
des sokratischen Trugschlusses. Damit ist ein Argument verbunden, dass dem hier<br />
vorgetragenen Einwand sehr ähnlich ist. Der Vorwurf: SOKRATES unterstellt fälschlich, dass<br />
ohne klärende Definition eine sinnvolle Verwendung eines Begriffs nicht möglich sei. Das<br />
kommt sachlich den hier formulierten sprachphilosophischen Einwendungen gegen die<br />
Methode der aporetischen Definitionsdialoge sehr nahe. Fast könnte man sagen: Das<br />
jeweils gleiche Argument wird unter nur leicht verschiedenen Blickwinkeln vorgetragen.<br />
72 <strong>Platon</strong>: Sämtliche Dialoge. Bd III. Übersetzt von Otto Apelt. Hamburg: Meiner Verlag 1988. S. 27f<br />
73 Das ist eine sehr verkürzte Wiedergabe der Einwände des SOKRATES, aber sein etwas verwickeltes Argumentieren,<br />
bei dem er einen Umweg über das Schöne macht, interessiert im Augenblick nicht.<br />
74 <strong>Platon</strong>: Sämtliche Dialoge. Bd III. Übersetzt von Otto Apelt. Hamburg: Meiner Verlag 1988. S. 42<br />
75 <strong>Platon</strong>: Sämtliche Dialoge. Bd III. Übersetzt von Otto Apelt. Hamburg: Meiner Verlag 1988. S. 57<br />
-35-