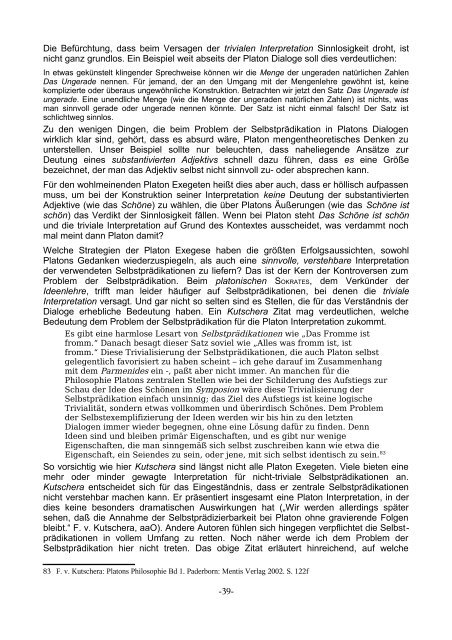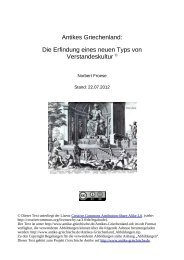Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Befürchtung, dass beim Versagen der trivialen Interpretation Sinnlosigkeit droht, ist<br />
nicht ganz grundlos. Ein Beispiel weit abseits der <strong>Platon</strong> Dialoge soll dies verdeutlichen:<br />
In etwas gekünstelt klingender Sprechweise können wir die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen<br />
Das Ungerade nennen. Für jemand, der an den Umgang mit der Mengenlehre gewöhnt ist, keine<br />
komplizierte oder überaus ungewöhnliche Konstruktion. Betrachten wir jetzt den Satz Das Ungerade ist<br />
ungerade. Eine unendliche Menge (wie die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen) ist nichts, was<br />
man sinnvoll gerade oder ungerade nennen könnte. Der Satz ist nicht einmal falsch! Der Satz ist<br />
schlichtweg sinnlos.<br />
Zu den wenigen Dingen, die beim Problem der Selbstprädikation in <strong>Platon</strong>s Dialogen<br />
wirklich klar sind, gehört, dass es absurd wäre, <strong>Platon</strong> mengentheoretisches Denken zu<br />
unterstellen. Unser Beispiel sollte nur beleuchten, dass naheliegende Ansätze zur<br />
Deutung eines substantivierten Adjektivs schnell dazu führen, dass es eine Größe<br />
bezeichnet, der man das Adjektiv selbst nicht sinnvoll zu- oder absprechen kann.<br />
Für den wohlmeinenden <strong>Platon</strong> Exegeten heißt dies aber auch, dass er höllisch aufpassen<br />
muss, um bei der Konstruktion seiner Interpretation keine Deutung der substantivierten<br />
Adjektive (wie das Schöne) zu wählen, die über <strong>Platon</strong>s Äußerungen (wie das Schöne ist<br />
schön) das Verdikt der Sinnlosigkeit fällen. Wenn bei <strong>Platon</strong> steht Das Schöne ist schön<br />
und die triviale Interpretation auf Grund des Kontextes ausscheidet, was verdammt noch<br />
mal meint dann <strong>Platon</strong> damit?<br />
Welche Strategien der <strong>Platon</strong> Exegese haben die größten Erfolgsaussichten, sowohl<br />
<strong>Platon</strong>s Gedanken wiederzuspiegeln, als auch eine sinnvolle, verstehbare Interpretation<br />
der verwendeten Selbstprädikationen zu liefern? Das ist der Kern der Kontroversen zum<br />
Problem der Selbstprädikation. Beim platonischen SOKRATES, dem Verkünder der<br />
Ideenlehre, trifft man leider häufiger auf Selbstprädikationen, bei denen die triviale<br />
Interpretation versagt. Und gar nicht so selten sind es Stellen, die für das Verständnis der<br />
Dialoge erhebliche Bedeutung haben. Ein Kutschera Zitat mag verdeutlichen, welche<br />
Bedeutung dem Problem der Selbstprädikation für die <strong>Platon</strong> Interpretation zukommt.<br />
Es gibt eine harmlose Lesart von Selbstprädikationen wie „Das Fromme ist<br />
fromm.“ Danach besagt dieser Satz soviel wie „Alles was fromm ist, ist<br />
fromm.“ Diese Trivialisierung der Selbstprädikationen, die auch <strong>Platon</strong> selbst<br />
gelegentlich favorisiert zu haben scheint – ich gehe darauf im Zusammenhang<br />
mit dem Parmenides ein -, paßt aber nicht immer. An manchen für die<br />
<strong>Philosophie</strong> <strong>Platon</strong>s zentralen Stellen wie bei der Schilderung des Aufstiegs zur<br />
Schau der Idee des Schönen im Symposion wäre diese Trivialisierung der<br />
Selbstprädikation einfach unsinnig; das Ziel des Aufstiegs ist keine logische<br />
Trivialität, sondern etwas vollkommen und überirdisch Schönes. Dem Problem<br />
der Selbstexemplifizierung der Ideen werden wir bis hin zu den letzten<br />
Dialogen immer wieder begegnen, ohne eine Lösung dafür zu finden. Denn<br />
Ideen sind und bleiben primär Eigenschaften, und es gibt nur wenige<br />
Eigenschaften, die man sinngemäß sich selbst zuschreiben kann wie etwa die<br />
Eigenschaft, ein Seiendes zu sein, oder jene, mit sich selbst identisch zu sein. 83<br />
So vorsichtig wie hier Kutschera sind längst nicht alle <strong>Platon</strong> Exegeten. Viele bieten eine<br />
mehr oder minder gewagte Interpretation für nicht-triviale Selbstprädikationen an.<br />
Kutschera entscheidet sich für das Eingeständnis, dass er zentrale Selbstprädikationen<br />
nicht verstehbar machen kann. Er präsentiert insgesamt eine <strong>Platon</strong> Interpretation, in der<br />
dies keine besonders dramatischen Auswirkungen hat („Wir werden allerdings später<br />
sehen, daß die Annahme der Selbstprädizierbarkeit bei <strong>Platon</strong> ohne gravierende Folgen<br />
bleibt.“ F. v. Kutschera, aaO). Andere Autoren fühlen sich hingegen verpflichtet die Selbstprädikationen<br />
in vollem Umfang zu retten. Noch näher werde ich dem Problem der<br />
Selbstprädikation hier nicht treten. Das obige Zitat erläutert hinreichend, auf welche<br />
83 F. v. Kutschera: <strong>Platon</strong>s <strong>Philosophie</strong> Bd 1. Paderborn: Mentis Verlag 2002. S. 122f<br />
-39-