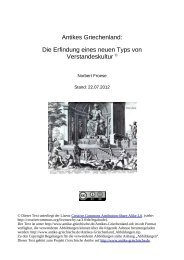Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
wird auch eine Mehr- oder Vielzahl von Wächtern im engeren Sinne mit den Regenten identifiziert. Erst<br />
im Dialog Der Staatsmann wird das Modell des Philosophenkönigs in aller Klarheit ausgesprochen und<br />
verteidigt. Das klassisch gewordene Bild, der Idealstaat, der von einem Philosophenkönig regiert wird,<br />
ergibt sich erst dann in voller Deutlichkeit, wenn man den Dialog Der Staatsmann mit heranzieht.<br />
Beim Aufkommen der Frage was nun genau zur Teilnahme an der Herrschaftsausübung<br />
im Idealstaat qualifizieren soll, kommt die Einsicht in das Wesen des Guten ins Spiel. Ein<br />
Regent muss wissen was gut ist:<br />
SOKRATES: Unsere Verfassung wird also doch dann ihre abschließende Ordnung<br />
und Gestaltung erhalten haben, wenn ein Wächter dieser Art die Aufsicht über<br />
sie führt, ein solcher nämlich, der die volle Kenntnis dieser Dinge besitzt?<br />
Adeimantos: Notwendig. Aber du selbst, mein Sokrates, wofür erklärst du denn<br />
das Gute? Für Einsicht oder für Lust oder für etwas anderes, von diesen<br />
Abweichendes? (Der Staat; 506 St.) 108<br />
SOKRATES antwortet zunächst ausweichend. Auch als GLAUKON darauf insistiert, dass<br />
SOKRATES sich dazu äußert, was genau es damit auf sich hat, verweigert SOKRATES eine<br />
direkte Antwort. <strong>Platon</strong> lässt hier seinen platonischen SOKRATES ausweichen:<br />
SOKRATES: (...) Aber, ihr Trefflichen, das eigentliche Wesen des Guten wollen wir<br />
jetzt auf sich beruhen lassen; denn für unseren derzeitigen Anlauf ist es,<br />
glaube ich, schon zu viel gefordert jetzt auch nur das zu erreichen, was ich so<br />
vorläufig über die Sache meine. Aber einen Sprößling des Guten, als welcher<br />
er mir erscheint, und ein volles Ebenbild desselben, das will ich euch durch<br />
meine Rede vorführen, wenn es euch erwünscht ist; sonst nicht.<br />
(Der Staat; 506 St.) 109<br />
Es folgt das Sonnengleichnis (und kurz danach werden das Linien- wie das Höhlengleichnis<br />
erzählt).<br />
Wie bei <strong>Platon</strong> fast üblich, werden dem platonischen SOKRATES gerade an den entscheidenden<br />
Passagen Vorbehalte und/oder Relativierungen bezüglich der für die Ideenlehre<br />
essentiellen Punkte in den Mund gelegt. Nicht nur, dass sich der platonische<br />
SOKRATES zum Ausweichen in die bildhafte und wenig fassliche Welt der Gleichnisse<br />
entschließt, sondern selbst das nachfolgende Sonnengleichnis (der Sprößling) erscheint<br />
SOKRATES nur als ein Sprößling des Guten. <strong>Platon</strong> baut an dieser Stelle also zusätzliche<br />
Sicherungen ein, damit man ihm nicht irgendwelche eindeutigen Aussagen zuordnen<br />
kann. Dass er sowieso nur den platonischen SOKRATES (und keinen PLATON) sprechen lässt,<br />
scheint ihm an dieser Stelle nicht mehr zu reichen.<br />
Es ist eine Flucht ins etwas Unbestimmte und Tentative. Und es ist leider das noch immer<br />
Deutlichste, was <strong>Platon</strong> zum Wesen des Guten (der Idee des Guten) zu sagen hat. Das<br />
Arbeiten mit den Gleichnissen ist rhetorisch recht trickreich. Bisher ist man sich im Dialog<br />
Der Staat darüber einig geworden, dass er ständisch organisiert sein soll und über eine<br />
Kriegerkaste (die Wächter) verfügen muss. Aus dieser Kriegerkaste soll die<br />
Herrschaftselite hervorgehen. Von den Herrschenden (den Regenten) selbst, verlangt<br />
man, dass sie einsichtsvoll sind und erkennen können was gut ist. Das ist zwar keine<br />
besonders inhaltsschwere Bestimmung, aber doch auch irgendwie ein Gemeinplatz, dem<br />
man nicht unbedingt widersprechen möchte. Wie kommt man nun von einem solchen<br />
Gemeinplatz zu den recht steilen Behauptungen der Ideenlehre? Durch Bedeutungsverschiebung!<br />
Bereits bei der Diskussion des Menon haben wir gesehen, dass <strong>Platon</strong><br />
diesen Trick zu nutzen weiß. Damals ging es um Wissen, hier jetzt um das Gute. Das<br />
rhetorische Mittel, das in Der Staat zur Bedeutungsverschiebung eingesetzt wird, sind die<br />
Gleichnisse.<br />
108 <strong>Platon</strong>: Sämtliche Dialoge. Bd V. Übersetzt von Otto Apelt. Hamburg: Meiner Verlag 1988. S. 259<br />
109 <strong>Platon</strong>: Sämtliche Dialoge. Bd V. Übersetzt von Otto Apelt. Hamburg: Meiner Verlag 1988. S. 260<br />
-55-