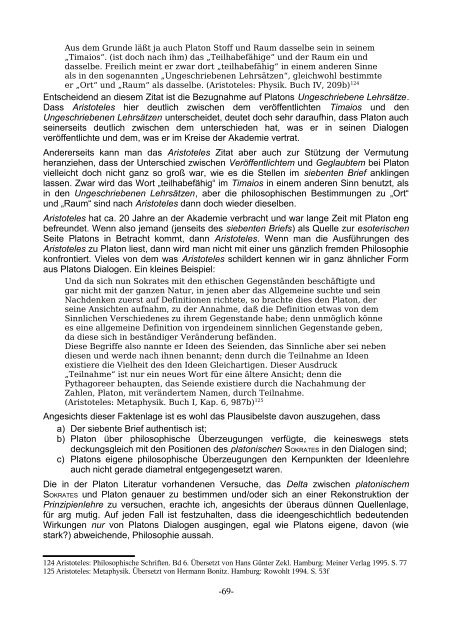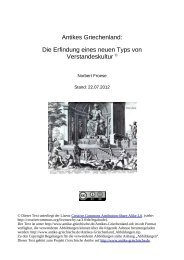Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aus dem Grunde läßt ja auch <strong>Platon</strong> Stoff und Raum dasselbe sein in seinem<br />
„Timaios“. (ist doch nach ihm) das „Teilhabefähige“ und der Raum ein und<br />
dasselbe. Freilich meint er zwar dort „teilhabefähig“ in einem anderen Sinne<br />
als in den sogenannten „Ungeschriebenen Lehrsätzen“, gleichwohl bestimmte<br />
er „Ort“ und „Raum“ als dasselbe. (Aristoteles: Physik. Buch IV, 209b) 124<br />
Entscheidend an diesem Zitat ist die Bezugnahme auf <strong>Platon</strong>s Ungeschriebene Lehrsätze.<br />
Dass Aristoteles hier deutlich zwischen dem veröffentlichten Timaios und den<br />
Ungeschriebenen Lehrsätzen unterscheidet, deutet doch sehr daraufhin, dass <strong>Platon</strong> auch<br />
seinerseits deutlich zwischen dem unterschieden hat, was er in seinen Dialogen<br />
veröffentlichte und dem, was er im Kreise der Akademie vertrat.<br />
Andererseits kann man das Aristoteles Zitat aber auch zur Stützung der Vermutung<br />
heranziehen, dass der Unterschied zwischen Veröffentlichtem und Geglaubtem bei <strong>Platon</strong><br />
vielleicht doch nicht ganz so groß war, wie es die Stellen im siebenten Brief anklingen<br />
lassen. Zwar wird das Wort „teilhabefähig“ im Timaios in einem anderen Sinn benutzt, als<br />
in den Ungeschriebenen Lehrsätzen, aber die philosophischen Bestimmungen zu „Ort“<br />
und „Raum“ sind nach Aristoteles dann doch wieder dieselben.<br />
Aristoteles hat ca. 20 Jahre an der Akademie verbracht und war lange Zeit mit <strong>Platon</strong> eng<br />
befreundet. Wenn also jemand (jenseits des siebenten Briefs) als Quelle zur esoterischen<br />
Seite <strong>Platon</strong>s in Betracht kommt, dann Aristoteles. Wenn man die Ausführungen des<br />
Aristoteles zu <strong>Platon</strong> liest, dann wird man nicht mit einer uns gänzlich fremden <strong>Philosophie</strong><br />
konfrontiert. Vieles von dem was Aristoteles schildert kennen wir in ganz ähnlicher Form<br />
aus <strong>Platon</strong>s Dialogen. Ein kleines Beispiel:<br />
Und da sich nun Sokrates mit den ethischen Gegenständen beschäftigte und<br />
gar nicht mit der ganzen Natur, in jenen aber das Allgemeine suchte und sein<br />
Nachdenken zuerst auf Definitionen richtete, so brachte dies den <strong>Platon</strong>, der<br />
seine Ansichten aufnahm, zu der Annahme, daß die Definition etwas von dem<br />
Sinnlichen Verschiedenes zu ihrem Gegenstande habe; denn unmöglich könne<br />
es eine allgemeine Definition von irgendeinem sinnlichen Gegenstande geben,<br />
da diese sich in beständiger Veränderung befänden.<br />
Diese Begriffe also nannte er Ideen des Seienden, das Sinnliche aber sei neben<br />
diesen und werde nach ihnen benannt; denn durch die Teilnahme an Ideen<br />
existiere die Vielheit des den Ideen Gleichartigen. Dieser Ausdruck<br />
„Teilnahme“ ist nur ein neues Wort für eine ältere Ansicht; denn die<br />
Pythagoreer behaupten, das Seiende existiere durch die Nachahmung der<br />
Zahlen, <strong>Platon</strong>, mit verändertem Namen, durch Teilnahme.<br />
(Aristoteles: Metaphysik. Buch I, Kap. 6, 987b) 125<br />
Angesichts dieser Faktenlage ist es wohl das Plausibelste davon auszugehen, dass<br />
a) Der siebente Brief authentisch ist;<br />
b) <strong>Platon</strong> über philosophische Überzeugungen verfügte, die keineswegs stets<br />
deckungsgleich mit den Positionen des platonischen SOKRATES in den Dialogen sind;<br />
c) <strong>Platon</strong>s eigene philosophische Überzeugungen den Kernpunkten der Ideenlehre<br />
auch nicht gerade diametral entgegengesetzt waren.<br />
Die in der <strong>Platon</strong> Literatur vorhandenen Versuche, das Delta zwischen platonischem<br />
SOKRATES und <strong>Platon</strong> genauer zu bestimmen und/oder sich an einer Rekonstruktion der<br />
Prinzipienlehre zu versuchen, erachte ich, angesichts der überaus dünnen Quellenlage,<br />
für arg mutig. Auf jeden Fall ist festzuhalten, dass die ideengeschichtlich bedeutenden<br />
Wirkungen nur von <strong>Platon</strong>s Dialogen ausgingen, egal wie <strong>Platon</strong>s eigene, davon (wie<br />
stark?) abweichende, <strong>Philosophie</strong> aussah.<br />
124 Aristoteles: Philosophische Schriften. Bd 6. Übersetzt von Hans Günter Zekl. Hamburg: Meiner Verlag 1995. S. 77<br />
125 Aristoteles: Metaphysik. Übersetzt von Hermann Bonitz. Hamburg: Rowohlt 1994. S. 53f<br />
-69-