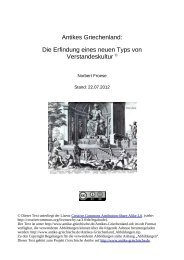Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Einsatz von Gleichnissen bietet <strong>Platon</strong> die Möglichkeit zu einem weiteren rhetorischen<br />
Trick: Statt über die in den Gleichnissen verpackten Inhalte streitig diskutieren zu lassen,<br />
wird im Dialog nur über die Frage der richtigen Interpretation der Gleichnisse gesprochen.<br />
<strong>Platon</strong> lässt den platonischen SOKRATES so ganz geschickt von der Frage der inhaltlichen<br />
Richtigkeit der vorgetragenen Thesen ablenken und ihn stattdessen eine Diskussion über<br />
die Interpretation der Gleichnisse steuern. <strong>Platon</strong> behandelt die von ihm selbst in die Welt<br />
gesetzten Gleichnisse dabei fast so, wie ein Theologe die Gleichnisse des Neuen<br />
Testaments. Die Auslegung der Gleichnisse ersetzt die offene inhaltliche Debatte.<br />
Vor den drei Gleichnissen hatte sich <strong>Platon</strong> nur bis zum Gemeinplatz, dass ein Herrscher<br />
einsichtsvoll sein soll und erkennen können muss, was gut ist, vorgearbeitet. Nach den<br />
drei Gleichnissen sind wir bei einem sehr dezidierten (und in allerlei philosophische Überzeugungen<br />
eingebetteten) Modell einer durch die Idee des Guten erleuchteten Herrschaft<br />
angekommen. Und dies alles, ohne dass uns <strong>Platon</strong> ein einziges überzeugendes<br />
Argument präsentiert hat.<br />
Die These, dass es einem Denker vom Range <strong>Platon</strong>s erlaubt sein müsse seine<br />
Überlegungen doch auch Mal etwas tentativ und in Form von Gleichnissen zu<br />
präsentieren, beeindruckt nicht wirklich. In allen Fragen, in denen es um die im Idealstaat<br />
auszuübende Zensur und Reglementierung des Lebens geht, fehlt nämlich dem selben<br />
Dialog alles Vorsichtige oder Tentative. Selbst das Recht, die eigene Bevölkerung zu<br />
täuschen, wird den von der Idee des Guten erleuchteten Herrschern ohne jede<br />
Zögerlichkeit zugestanden. (Wir werden auf diese Punkte im Abschnitt <strong>Platon</strong>s totalitäre<br />
Staatsutopien noch zu sprechen kommen.)<br />
Leser, die die Gleichnisse gerne selbst bei <strong>Platon</strong> nachlesen wollen, finden diese an<br />
folgenden Stellen im Staat:<br />
● Sonnengleichnis: 507a7 – 509c11<br />
● Liniengleichnis: 509d1 – 511e5<br />
● Höhlengleichnis: 514a1 – 518b5 110<br />
Das Sonnengleichnis<br />
Zur Einführung des Sonnengleichnisses greife ich auf ein Zitat von M. Bordt zurück.<br />
Im ersten Gleichnis (dem Sonnengleichnis; NF) führt <strong>Platon</strong> ein Bild ein, das<br />
grundlegend für alle drei Gleichnisse ist: das Bild der Sonne, mit der die Idee<br />
des Guten verglichen wird. Dafür hebt er vor allem drei Aspekte der Sonne<br />
und des Sonnenlichts hervor. Erstens ist die Sonne dadurch, daß sie Licht<br />
spendet, Ursache dafür, daß wir etwas sehen können. Wenn es kein Licht<br />
gäbe, wäre es unmöglich, etwas zu sehen. Durch das Licht werden die<br />
Gegenstände, die es gibt, für uns erst wahrnehmbar. Zweitens verursacht das<br />
Licht der Sonne nicht nur die Sichtbarkeit der Objekte, sondern ermöglicht<br />
erst unser Sehen. Durch unsere Augen haben wir zwar die Fähigkeit zu sehen,<br />
wir brauchen aber das Licht, damit diese Fähigkeit aktiviert wird. Die Sonne<br />
ist drittens aber nicht nur Grund der Sichtbarkeit und des Sehens, sondern<br />
auch der Grund dafür, daß die Lebewesen auf der Erde wachsen und sich<br />
ernähren können. (...)<br />
So wie die Sonne es durch ihr Licht ermöglicht, Gegenstände wahrnehmbar zu<br />
machen, so ist die Idee des Guten Ursache für die Erkennbarkeit der Dinge,<br />
die durch Denken erkennbar ist. So wie die Sonne zweitens das Sehen<br />
aktiviert, so aktiviert die Idee des Guten das Denken. Drittens ist die Idee des<br />
Guten auch der Grund dafür, daß die Dinge auf der Welt überhaupt das sind,<br />
was sie sind. 111<br />
110 Die Angaben sind für meine Verhältnisse ungewöhnlich präzis. Grund: Ich habe sie aus M. Bordts Buch <strong>Platon</strong><br />
übernommen. Für gewöhnlich sind meine Angaben deutlich ungenauer. Ich erspare mir nämlich gern das Abzählen<br />
von Zeilen. Der Leser möge mir verzeihen.<br />
111 M. Bordt: <strong>Platon</strong>. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder. S. 89f<br />
-56-