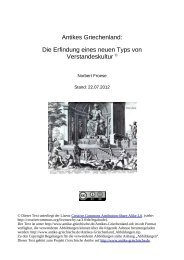Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der platonische SOKRATES<br />
Der platonische SOKRATES wurde schon mehrfach als der Verkünder der Ideenlehre<br />
apostrophiert. Es ist an der Zeit diese Formulierung etwas zu präzisieren.<br />
Der platonische SOKRATES lässt sich ganz natürlich als Fortentwicklung des SOKRATES der<br />
frühen aporetischen Definitionsdialoge verstehen. Auch der platonische SOKRATES hat eine<br />
ausgesprochene Vorliebe für Was ist X?-Fragen. Aber der platonische SOKRATES fängt an<br />
Antworten zu geben. <strong>Platon</strong> macht es uns jedoch nicht so einfach, dass zu Beginn des<br />
Dialogs eine Frage gestellt wird, die dann zuverlässig am Ende des Dialogs beantwortet<br />
ist. Im Gegenteil: Die Ausgangsfrage kann auch ohne klare Lösung im Raum stehen<br />
bleiben. Die Punkte, zu denen Lösungsansätze angeboten werden, betreffen unter<br />
Umständen nur Teilaspekte oder verwandte Fragestellungen.<br />
Mit einiger Vergröberung lässt sich für die Dialoge des platonischen SOKRATES folgendes<br />
Grundmuster angeben (die Schritte 2 und 3 sind optional; sie tauchen in etlichen Dialogen<br />
nicht auf):<br />
1. Aus irgendeinem Anlass kommt es zwischen SOKRATES und seinen Dialogpartnern<br />
zur Erörterung einer Was ist X?-Frage.<br />
2. Der platonische SOKRATES betont/demonstriert die Schwierigkeit der Was ist X?-<br />
Frage.<br />
3. Stattdessen werden andere Themen erwogen (über deren Beantwortung man<br />
vielleicht der ursprünglichen Was ist X?-Frage näher kommen kann).<br />
4. Zu den nun erwogenen Fragen werden Lösungsansätze erarbeitet oder es wird<br />
wenigstens die Richtung angegeben, in der man suchen sollte, um zu einer Lösung<br />
zu gelangen.<br />
5. Die Hinweise werden meist in Form von Beispielen, Gleichnissen oder einem (von<br />
<strong>Platon</strong> evtl. neu erfundenen) Mythos erteilt.<br />
6. Der Dialog endet, ohne dass die gefundenen Antworten völlig zurückgenommen<br />
werden.<br />
Es ist zwar nicht so, dass sich <strong>Platon</strong> strikt an dieses Muster hält, aber es ist ein brauchbarer<br />
erster Orientierungspunkt. Das, was wir heute Ideenlehre nennen, ist der Versuch<br />
die verschiedenen Hinweise, die der platonische SOKRATES – über die diversen Dialoge<br />
verstreut – erteilt hat, zu einer Gesamtsicht zusammen zu tragen. Ein Traktat, in dem<br />
<strong>Platon</strong> die Ideenlehre in geschlossener Form und systematisch entwickelt, existiert nicht.<br />
Obwohl sehr viele Dialoge Hinweise zum Thema Ideenlehre enthalten, sind vier Dialoge<br />
doch von ganz besonderer Bedeutung:<br />
Dialog Ursprüngliche Was ist X?-Frage Wichtiger Beitrag zur Ideenlehre<br />
Menon Was ist Tugend?<br />
(ergänzend: Ist Tugend lehrbar?)<br />
Wissen ist Erinnerung / Unterschied<br />
von wahrem Meinen und Wissen<br />
Das Gastmahl Was ist Liebe (Eros)? Der Aufstieg zur Welt der Ideen<br />
Der Staat Was ist Gerechtigkeit? (enthält die<br />
1. Staatsutopie - Philosophenkönig)<br />
vielfältig; Sonnen-, Linien- und<br />
Höhlengleichnis<br />
Phaidon Was ist die Seele? Seele als Mittler zur Welt der Ideen<br />
Alle vier Dialoge gehören zur Gruppe 2.<br />
Zur etwas näheren Beleuchtung des platonischen SOKRATES wird Material aus zwei<br />
Dialogen herangezogen: Menon und Der Staat.<br />
-43-