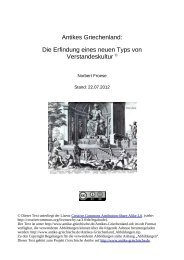Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anmerkungen zur Wirkungsgeschichte<br />
Die ideengeschichtlichen Wirkungen <strong>Platon</strong>s sind mächtig und vielfältig. Viele Hinweise zu<br />
diesem Thema wurden bereits in dieses Papier eingewoben. Sie sollen hier keinesfalls alle<br />
wiederholt werden.<br />
Der einflussreichste Denker, der aus <strong>Platon</strong>s Akademie hervorging ist sicherlich<br />
Aristoteles. Aristoteles lehnt zwar die Ideenlehre ab, bleibt aber mit seinem Konzept der<br />
Wesensdefinition deutlich der Tradition der Wesensphilosophie verbunden. Mit seiner<br />
Annahme von immateriell existierenden Formen macht er zudem deutlich von den neuen<br />
Möglichkeiten metaphysischen Denkens Gebrauch. Hinsichtlich politischer Fragen ist zwar<br />
auch Aristoteles nicht unbedingt als Demokrat einzustufen, aber bei allen autoritären<br />
Neigungen fehlen bei ihm doch die totalitären Visionen eines <strong>Platon</strong>s.<br />
Die Akademie wird nach <strong>Platon</strong>s Tod vom Sohn seiner Schwester Potone, seinem Neffen<br />
Speusippos, weiter geführt. Als neuer Leiter der Akademie beginnt er die Arbeit an der<br />
systematischen Ordnung der Schriften <strong>Platon</strong>s. Unter Arkesilaos (ca. 316 – 241 v.Chr.),<br />
einem späteren Leiter, ändert die Akademie ihre Ausrichtung grundlegend: Sie wird<br />
skeptisch. Die Skeptiker halten das sokratische Ich weiß, dass ich nicht weiß für die<br />
höchste und nicht übersteigbare Stufe der Erkenntnis. Hinsichtlich <strong>Platon</strong> können sie an<br />
dessen aporetische Definitionsdialoge anknüpfen.<br />
Unter etlichen weiteren Richtungswechseln besteht die Akademie bis 86 (v.Chr.) fort. Im<br />
Jahr 86 (v.Chr.) wird die Akademie bei der Eroberung Athens durch den römischen Konsul<br />
Sulla zerstört. Die weitere Tradierung der platonischen <strong>Philosophie</strong> ist aber sicher gestellt.<br />
Zu den bedeutenden (Neu-)<strong>Platon</strong>ikern der Spätantike gehören Plotin (ca. 205 – 270),<br />
Porphyrios (ca. 234 – 301) und Proklos 160 (ca. 410 – 485). Die Neuplatoniker der<br />
Spätantike befanden sich in einer intensiven Auseinandersetzung mit dem aufkommenden<br />
Christentum. Ihre philosophischen Lehren bestanden dabei nicht nur aus der bloßen<br />
Wiedergabe <strong>Platon</strong>s, sondern enthielten teilweise recht eigenständige Weiterentwicklungen.<br />
So steht Plotin in manchen Aspekten seiner <strong>Philosophie</strong> Hegel fast schon<br />
näher als <strong>Platon</strong>.<br />
Nach diversen nicht sehr erfolgreichen Versuchen einer Wiederbelebung der Akademie in<br />
Athen, gelingt es 410 (n.Chr.) endlich, den Betrieb der Akademie wieder dauerhaft aufzunehmen.<br />
529 wird dann aber dieser Lehrbetrieb vom christlichen Kaiser Justinian I.<br />
verboten. Das ist das endgültige Ende der Akademie in Athen.<br />
Über den Kirchenvater Augustinus (354 – 430) nimmt die platonische <strong>Philosophie</strong><br />
erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der katholischen Theologie. Im Mittelalter geht<br />
im katholischen Mitteleuropa der Kontakt zu den Schriften <strong>Platon</strong>s weitgehend verloren.<br />
Lediglich der Dialog Timaios ist noch bekannt, und auch das nur teilweise. In Byzanz<br />
(Konstantinopel) ist aber <strong>Platon</strong>s Schrifttum weiterhin vollständig verfügbar.<br />
Erst 1423 gibt es in Mitteleuropa wieder eine vollständige, griechische Ausgabe von<br />
<strong>Platon</strong>s Schriften. Sie wird 1484 ins Lateinische übersetzt. In der Renaissance greift man<br />
gerne auf <strong>Platon</strong> zurück, um die in der Scholastik dogmatisierten aristotelischen Lehren zu<br />
attackieren. In Italien kommt es zu dieser Zeit an verschiedenen Orten zur (manchmal<br />
jedoch nur symbolischen) Wiederbelebung der Tradition der Akademie.<br />
In Deutschland erhält die Auseinandersetzung mit <strong>Platon</strong> Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
durch die Übersetzungen von Schleiermacher (1768 – 1834) neuen Auftrieb.<br />
160 Proklos ist dabei auch eine ungeheuer wichtige Quelle für die <strong>Mathematik</strong>-Geschichte.<br />
-84-