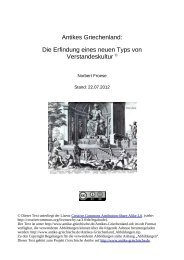Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das obige Bordt Zitat fasst das Sonnengleichnis, sowie die im Anschluss von SOKRATES<br />
selbst gelieferte Interpretation knapp und bündig zusammen. Was können wir aus dem<br />
Gleichnis lernen? Jemand, der sich für die antike Geschichte der Optik interessiert, kann<br />
dem Gleichnis zunächst einmal entnehmen, dass es <strong>Platon</strong> noch für angemessen hielt,<br />
zwischen Sichtbarkeit der Objekte und dem Sehen der Objekte durch unser Auge zu<br />
unterscheiden. Das ist aber sicherlich nicht der Typus von Information, der hier vorrangig<br />
interessiert.<br />
Es werden durch das Gleichnis drei gleichermaßen steile, wie begründungsfrei<br />
vorgetragene Behauptungen präsentiert:<br />
● Die Idee des Guten ist der Grund für die Erkennbarkeit der Dinge;<br />
● Die Idee des Guten aktiviert unser Denken (die Vernunft);<br />
● Die Idee des Guten ist die Ursache des Seins bzw. Soseins alles Existierenden.<br />
Durch Verwendung der Metapher Sonne – ein Ursymbol für Göttlichkeit – und die<br />
(absichtlich eingesetzte?) Dreiheit der Behauptungen bekommt das Ganze einen etwas<br />
religiösen Beigeschmack. 112 Wir sind jetzt aber zumindest deutlich über die Bedeutung die<br />
der platonische SOKRATES der Idee des Guten beimisst informiert.<br />
Man kann das Sonnengleichnis dazu benutzen, um einige für den platonischen SOKRATES<br />
typische Grundüberzeugungen zu beleuchten:<br />
Die Idee des Guten ist die höchste aller Ideen.<br />
Die Welt der Ethik (der nach moderner Sicht die Idee des Guten wohl zuzurechnen<br />
ist) dominiert alle Aspekte des Seins und des Erkennens.<br />
Es gibt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Ethischem und Nicht-Ethischem.<br />
Wir sind dieser Sichtweise schon im Dialog Menon begegnet. Die Seele hat die<br />
Welt der Ideen geschaut und kann sich deswegen (angemessenes Bemühen<br />
vorausgesetzt) gleichermaßen an mathematische Tatsachen (Wie verdoppelt man<br />
die Fläche eines Quadrats?) wie ethische Tatsachen (Was ist das Wesen der<br />
Tugend?) erinnern.<br />
Mit etwas Großzügigkeit kann man das Sonnengleichnis auch als Beleg dafür<br />
heranziehen, dass nur das Denken (und nicht der Gebrauch der Sinne) den Weg zu<br />
echter Erkenntnis ebnet. Schließlich wird nur das Denken, nicht aber der Gebrauch<br />
der Sinne, durch die Idee des Guten aktiviert.<br />
Die Radikalität, mit der der platonische SOKRATES die Idee des Guten zur Grundlage<br />
jedweder Art von Erkenntnis macht, ist für uns heute etwas befremdlich.<br />
Wie läßt sich die Behauptung verständlich machen, daß ohne die Idee des<br />
Guten überhaupt keine Erkenntnis möglich ist und die Idee des Guten insofern<br />
noch über dem Wesen und dem Sein steht? Daß jemand wissen muß, was das<br />
Gute ist, um wissen zu können, was eine bestimmte Tugend ist, ist<br />
unproblematisch (...). Problematisch ist aber die These, daß jemand zur<br />
Erkenntnis von Dingen, die mit Ethik und Moral gar nichts zu tun haben,<br />
wissen muß, was das Gute ist. Spätestens seit Immanuel Kants Unterscheidung<br />
zwischen theoretischer und praktischer Vernunft unterscheidet man zwischen<br />
objektiven Tatsachen und Wertvorstellungen. 113<br />
Man wird hier daran erinnert, dass auch die für uns heute selbstverständlichsten Unterscheidungen<br />
erst einmal gefunden werden mussten.<br />
Kommen wir zum nächsten Gleichnis, dem Liniengleichnis.<br />
112 Die Dreiheit als Ausdruck von Heiligkeit war in der <strong>Antike</strong> bei religiösen Kulten schon lange vor der Erfindung der<br />
Heiligen Dreieinigkeit durch das Christentum gebräuchlich.<br />
113 M. Bordt: <strong>Platon</strong>. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder. S. 91<br />
-57-