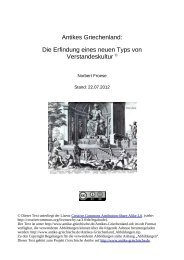Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
erkennen, daß es die Sonne ist, die die Jahreszeiten schafft und so Ursache von<br />
allem ist. Jetzt erst versteht er den Zustand der Menschen, die gefesselt die<br />
Schattenwelt für die Wirklichkeit halten. Ihn treibt es, wieder zurück in die<br />
Höhle zu gehen und die Menschen über ihre wahre Situation aufzuklären. Die<br />
Menschen aber, die sich in ihrer Scheinwelt von Geschäften und Alltagssorgen<br />
wohlfühlen und eingerichtet haben, wollen ihn nicht hören; der Unwille wird<br />
so weit gehen, daß sie ihn umbringen wollen (...). 116<br />
Mit der Angabe, dass die in der Höhle Zurückgebliebenen die Belehrungen durch den<br />
Rückkehrer ablehnen, weil sie sich in ihrer Scheinwelt von Geschäften und Alltagssorgen<br />
wohlfühlen verlässt Bordt den Boden einer textnahen Wiedergabe des Höhlengleichnisses<br />
und geht bruchlos zu einer eigenen und etwas eigenwilligen Interpretation des<br />
Höhlengleichnisses über. Ansonsten bin ich jedoch mit seiner Zusammenfassung des<br />
Höhlengleichnisses einverstanden. Sehen wir uns aber doch genauer an, welche Gründe<br />
<strong>Platon</strong> dafür anführt, dass jener Rückkehrer vom Sonnenlicht niemand überzeugen kann:<br />
SOKRATES: Und nun bedenke auch noch folgendes: wenn ein solcher wieder<br />
hinabstiege in die Höhle und dort wieder seinen alten Platz einnähme, würden<br />
seine Augen nicht förmlich eingetaucht werden in Finsternis, wenn er plötzlich<br />
aus der Sonne dort anlangte?<br />
GLAUKON: Gewiß.<br />
SOKRATES: Wenn er nun wieder, bei noch anhaltender Trübung des Blicks mit<br />
jenen ewig Gefesselten wetteifern müßte in der Deutung der Schattenbilder,<br />
ehe noch seine Augen sich der jetzigen Lage wieder völlig angepaßt haben –<br />
und die Gewöhnung daran dürfte eine ziemlich erhebliche Zeit fordern – würde<br />
er sich da nicht lächerlich machen und würde es nicht von ihm heißen, sein<br />
Aufstieg nach oben sei schuld daran, daß er mit verdorbenen Augen<br />
wiedergekehrt sei, und schon der bloße Versuch nach oben zu gelangen, sei<br />
verwerflich? Und wenn sie den, der es etwa versuchte sie zu entfesseln und<br />
hinaufzuführen, irgendwie in ihre Hand bekommen und umbringen könnten, so<br />
würden sie ihn doch auch umbringen?<br />
GLAUKON: Sicherlich. (Der Staat; 516 - 517 St.) 117<br />
Das klingt doch etwas anders als die Formulierungen bei Bordt.<br />
In den nachfolgenden Passagen erläutert SOKRATES das Höhlengleichnis. Dabei wird, wenig<br />
überraschend, die Sonne wieder mit der Idee des Guten identifiziert. Vor diesem<br />
Hintergrund lassen sich die Schatten an der Höhlenwand mühelos als unsere sinnliche<br />
Erfahrungswelt deuten. Die sinnlich wahrnehmbaren Dinge sind eben unstet und<br />
deswegen keinem tieferen Verständnis zugänglich. <strong>Platon</strong>s Anlehnung an Heraklit wie<br />
Kratylos und besonders seine Annahme, dass Erkenntnis einen unveränderlichen Gegenstand<br />
erfordert, bilden dabei den Hintergrund für <strong>Platon</strong>s Verachtung der Sinnenwelt.<br />
Betrachten wir aus dieser Sicht die Situation des Rückkehrers: Der, der also den Aufstieg<br />
zur Idee des Guten geschafft hat, (der sich dessen wiedererinnert, was seine Seele schon<br />
geschaut hatte) muss fürchten, dass ihn seine weniger einsichtsvollen Mitbürger töten<br />
wollen. Diese weniger einsichtsvollen Mitbürger ziehen es zudem vor, ihre sinnlichen<br />
Wahrnehmungen (die Schatten an der Höhlenwand) als Grundlage ihrer Urteile zu<br />
verwenden (und erscheinen deswegen dem platonischen SOKRATES als arg borniert). Bei<br />
solchen sich dem Empirischen widmenden Erkenntnisbemühungen kann dann zwar der<br />
um die Idee des Guten Wissende (zunächst) nicht mithalten, aber das ist bedeutungslos,<br />
denn er hat ja die Idee des Guten geschaut. (Der etwas polemische Unterton der<br />
Formulierungen ist durchaus gewollt! Der sachliche Kern der Behauptungen ist aber –<br />
leider! – bei <strong>Platon</strong> jederzeit nachzulesen.)<br />
116 M. Bordt: <strong>Platon</strong>. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder. S. 128<br />
117 <strong>Platon</strong>: Sämtliche Dialoge. Bd V. Übersetzt von Otto Apelt. Hamburg: Meiner Verlag 1988. S. 272f<br />
-60-