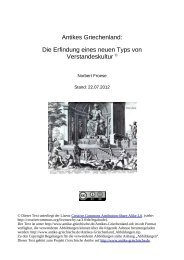Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Höhlengleichnis als Schlüsselstelle im Dialog Der Staat (Politeia)<br />
Man hielt sich immer für verpflichtet, Plato in den Himmel zu heben, nicht<br />
aber ihn zu verstehen. Das ist nun einmal das Schicksal großer Männer.<br />
Ich beabsichtige das Gegenteil zu tun. Ich möchte ihn verstehen, ohne<br />
ihn dabei mit mehr Ehrfurcht zu behandeln, als ich für einen zeitgenössischen<br />
Vorkämpfer des Totalitarismus in England oder Amerika<br />
empfinde.<br />
Bertrand Russell<br />
Der Staat (Politeia) ist der hinsichtlich Ideenlehre ergiebigste Dialog <strong>Platon</strong>s. Er gilt<br />
gemeinhin auch als sein Hauptwerk. Der Dialog hat das Volumen eines kompletten<br />
Buches und wird üblicherweise auch als eigenständiges Buch verlegt. Der Versuch,<br />
diesen Dialog im eben bei Menon praktizierten Stil zu analysieren, würde dieses eh schon<br />
etwas lang geratene Einführungspapier in ein voluminöses Monstrum verwandeln.<br />
Der Hauptbeitrag der Politeia zur Popularität der Ideenlehre liegt im enthaltenen<br />
Höhlengleichnis. Deswegen liegt nichts näher, als sich auf dieses Gleichnis zu<br />
konzentrieren. (Ich gebe auch gerne gleich zu, dass ich dabei die Absicht verfolge, das<br />
Höhlengleichnis als angebliches Highlight der europäischen Geistesgeschichte etwas zu<br />
entzaubern.) Trotz der Fokussierung auf dieses Gleichnis sollen vorweg einige wenige<br />
Angaben zum allgemeinen Aufbau und Inhalt des Dialogs gemacht werden.<br />
Der Dialog enthält verschiedene Erzählebenen. Er ist hinsichtlich seiner formalen<br />
literarischen Struktur wesentlich komplexer als die bisher betrachteten Dialoge aufgebaut.<br />
Neben der Figur SOKRATES tauchen in dem Dialog sechs weitere Figuren auf. Für die hier<br />
besonders interessierenden Stellen sind aber neben SOKRATES nur GLAUKON und ADEIMANTOS<br />
relevant 102 . Das Höhlengleichnis wird zu Beginn des Buchs sieben des Dialogs Der Staat<br />
erzählt. Unmittelbar vorher (Ende Buch sechs) werden das Sonnen- und Liniengleichnis<br />
geschildert. Die drei Gleichnisse (Sonnen-, Linien- und Höhlengleichnis) stehen in engem<br />
Zusammenhang miteinander. Deswegen werden wir auch einen kurzen Blick auf Sonnen-<br />
und Liniengleichnis werfen.<br />
Der Dialog beginnt mit einer Erörterung der Frage Was ist Gerechtigkeit? SOKRATES leitet<br />
jedoch schnell zur Frage nach dem idealen Staat über. Weit vor den Passagen, die hier<br />
eigentlich interessieren, wird eine Auseinandersetzung zwischen SOKRATES und<br />
THRASYMACHOS beschrieben. Die Figur THRASYMACHOS ist eine Anspielung auf die historische<br />
Person gleichen Namens, einen Sophisten. Über den historischen Thrasymachos wissen<br />
wir nur äußerst wenig. Zu den spärlichen Informationen zu Thrasymachos, über die wir<br />
(unabhängig von <strong>Platon</strong>s Anti-Sophisten Propaganda) verfügen, zählt ein kurzes<br />
Fragment:<br />
Die Götter haben die menschliche Lebenswelt nicht im Auge. Denn<br />
anderenfalls hätten sie nicht das größte der Güter für die Menschen außer<br />
acht gelassen, die Gerechtigkeit. Denn wir sehen die Menschen diese nicht<br />
benutzen. 103<br />
Das wirkt auf mich nun nicht gerade besonders unsympathisch. <strong>Platon</strong> hingegen zeichnet<br />
THRASYMACHOS als echten Widerling. Ich will die Gelegenheit nutzen, um dem Leser<br />
wenigstens an Hand einer einzigen Stelle vorzuführen, zu welchen Mitteln <strong>Platon</strong> bei<br />
seiner Kampagne gegen Sophisten greift. Hier der Auftritt von THRASYMACHOS, SO wie <strong>Platon</strong><br />
ihn für diese Figur gestaltet hat. SOKRATES erzählt:<br />
102 Die Figuren GLAUKON und ADEIMANTOS sind Anspielungen <strong>Platon</strong>s auf seine älteren Brüder gleichen Namens. Ersetzt<br />
man (gedanklich) SOKRATES durch PLATON, so sind die gerade entscheidendsten Teile des Dialogs Der Staat eine Art<br />
Familiengespräch im Hause <strong>Platon</strong>. Da es hier um eine Neubegründung von elitärer Herrschaft geht, hat die<br />
Benennung der Rollen, zu der sich <strong>Platon</strong> entschlossen hat, nicht wenig zum Athener Gespött beigetragen, dass<br />
<strong>Platon</strong> königliches Blut in sich verspüre (siehe seine Abstammung von Kodros) und er sich zum Philosophenkönig<br />
berufen fühle. Ein Gespött, das sich <strong>Platon</strong> redlich verdient hat.<br />
103 Thrasymachos, Fragment (DK 85 B 8) zitiert nach: Bernhard H.F. Taureck: Die Sophisten. Junius Verlag. S. 79<br />
-52-