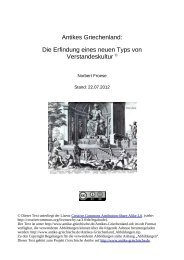Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Platon</strong>s totalitäre Staatsutopien<br />
Im Jahre 1937 resümiert Wilhelm Nestle den Gehalt der Staatslehre <strong>Platon</strong>s wie folgt:<br />
Das sind <strong>Platon</strong>s Hauptgedanken über Staatsführung in den verschiedenen<br />
Stadien seines politischen Denkens. Trotz aller Verschiedenheiten bleiben<br />
darin drei Grundüberzeugungen unverändert:<br />
1. Der Staat ist ein Organismus, wodurch eine mechanische Gleichheit der<br />
Bürger ausgeschlossen ist.<br />
2. Dieser Organismus muss ein Haupt haben, und dieses wäre am besten eine<br />
geistig und sittliche Führerpersönlichkeit, an die freilich so hohe<br />
Anforderungen gestellt werden müssen, daß sie sich nur selten finden wird.<br />
3. Der Staat muß auf sittlicher Grundlage ruhen und seine Hauptaufgabe ist<br />
daher die Volkserziehung, die allein für das Wohl des Ganzen verbürgt. 126<br />
Kleine Anmerkung: Man kann dem gebildeten Humanisten und Professor für griechische<br />
<strong>Philosophie</strong> (Tübingen, seit 1933) sicherlich vieles Vorhalten, aber eine mangelnde<br />
Kenntnis des antiken Schrifttums bestimmt nicht.<br />
Im selben Jahr (1937) emigrierte der österreichische Philosoph Karl Popper nach<br />
Neuseeland und begann dort wenig später sein Werk Die offene Gesellschaft und ihre<br />
Feinde zu schreiben. Der erste Band dieses Werks (Der Zauber <strong>Platon</strong>s) ist das im<br />
deutschsprachigen Raum wohl am häufigsten kritisierte bzw. meist verrissene <strong>Platon</strong><br />
Buch. Im Vorwort zur amerikanischen Ausgabe des Buchs (1950) schreibt Popper:<br />
Vieles, was in diesem Werk enthalten ist, nahm zu einem früheren Zeitpunkt<br />
Gestalt an; aber den Entschluß zur Niederschrift faßte ich im März 1938, als<br />
mich die Nachricht von der Invasion Österreichs erreichte. Die Niederschrift<br />
erstreckte sich bis ins Jahr 1943, und der Umstand, daß der größte Teil<br />
während jener schweren Jahre geschrieben wurde, wo der Ausgang des<br />
Krieges ungewiß war, mag vielleicht erklären, warum mir heute manche<br />
meiner kritischen Bemerkungen emotionaler und in der Formulierung härter<br />
erscheinen, als ich es jetzt wünschte. 127<br />
Worum geht es Popper in Der Zauber <strong>Platon</strong>s? Popper will aufzeigen, auf welch vielfältige<br />
Weise <strong>Platon</strong> totalitäre Denkmuster befördert. Und er will auch aufzeigen, welch<br />
bedenklichen Einfluss dessen Ideen auf die europäische Geistesgeschichte nahmen.<br />
Einer der zentralen Vorwürfe Poppers an die Adresse <strong>Platon</strong>s lautet, dass dieser einem<br />
Modell totalitärer Gerechtigkeit huldige:<br />
Die Grundelemente, an die ich hier denke, sind:<br />
[A] Die strenge Klassenteilung; das heißt die herrschende Klasse, bestehend<br />
aus Hirten und Wachhunden, muss streng vom menschlichen Herdenvieh<br />
geschieden werden.<br />
[B] Die Identifikation des Schicksals des Staates mit dem Schicksal der<br />
herrschenden Klasse; das ausschließliche Interesse an dieser Klasse und an<br />
ihrer Einheit; und, im Dienste dieser Einheit, die starren Regeln zur<br />
Züchtigung und Erziehung dieser Klasse sowie die strenge Überwachung ihrer<br />
Mitglieder und die Kollektivierung all ihrer Interessen.<br />
Aus diesen Grundelementen lassen sich andere Elemente herleiten, zum<br />
Beispiel die folgenden:<br />
[C] Die herrschende Klasse hat ein Alleinrecht auf Dinge wie kriegerische<br />
Tugenden und militärische Ausbildung; sie allein darf Waffen tragen und sie<br />
allein hat Anspruch auf Erziehung jeglicher Art; sie ist aber von der Teilnahme<br />
an wirtschaftlicher Tätigkeit, insbesondere vom Geldverdienen, zur Gänze<br />
ausgeschlossen.<br />
126 Wilhem Nestle: Der Führergedanke in der platonischen und aristotelischen Staatslehre. in: Das Gymnasium; 48.<br />
Jahrgang, Heft 3. 1937. S. 82 (Hervorhebungen im Text)<br />
127 Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde Bd 1. München: Francke Verlag 1980. S. 6<br />
-70-