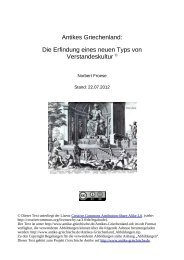Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Antike Philosophie: Platon - Mathematik ... - Griechische Antike
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der SKLAVE findet im dritten Anlauf die Lösung. Die beiden ersten Anläufe gehen fehl und<br />
mit Hilfe von SOKRATES sieht der SKLAVE seine Fehler auch jeweils schnell ein. An MENON<br />
gerichtet kommentiert SOKRATES, dies jeweils als zunehmende Einsicht in das Nicht-<br />
Wissen: Eine wichtige Vorstufe zu echter Erkenntnis. (Hier verbeugt sich der Autor <strong>Platon</strong><br />
noch einmal deutlich vor seinem Lehrer, dem historischen Sokrates, dessen Erkenntnis<br />
aus dem berühmten Ich weiß, dass ich nicht weiß bestand.)<br />
Diese im Menon enthaltene Passage (inkl. der Dialogsequenz mit dem SKLAVEN) ist sehr<br />
wahrscheinlich die älteste Textstelle, in der der platonische SOKRATES Wissen als Erinnern<br />
deutet. Wohl von hier aus findet die These ihren Eingang in die Ideenlehre.<br />
MENON zeigt sich nach dieser Vorführung beeindruckt. Nach nochmaliger Versicherung,<br />
dass der SKLAVE keinerlei geometrische Erziehung oder Ausbildung genossen hat, kommt<br />
es zu folgendem Resümee:<br />
SOKRATES: Wenn nun die Wahrheit über das Sein der Dinge unserer Seele jederzeit<br />
innewohnt, muß dann die Seele nicht unsterblich sein? Also voll froher Zuversicht<br />
mußt du den Versuch machen, dem, was du jetzt zufällig nicht weißt, mit anderen<br />
Worten, woran du dich nicht erinnerst, nachzuforschen und die Erinnerung daran<br />
aufzufrischen.<br />
MENON: Sonderbar, mein Sokrates, aber es kommt mir vor, als ob du recht hättest.<br />
SOKRATES: Auch mir, mein Menon. Und im übrigen möchte ich für das Gesagte nicht<br />
in vollem Nachdruck einstehen. (...)<br />
Es sind drei, für <strong>Platon</strong> nicht gerade untypische Merkmale an dieser Passage<br />
hervorzuheben:<br />
● SOKRATES versieht seine Behauptungen am Schluss mit einem Vorbehalt. Er will<br />
nicht mit vollen Nachdruck für das Gesagte einstehen.<br />
● Zur Stützung zentraler Thesen der Ideenlehre wird auf Beispiele aus dem Umfeld<br />
der <strong>Mathematik</strong> zurückgegriffen.<br />
● Die tatsächlich im Dialog enthaltene argumentative Substanz ist minimal. (Die<br />
Aufgabe sich zu überlegen, auf welche Weise das menschliche Talent zur Einsicht<br />
in mathematische Sachverhalte als Argument für die These Wissen = Erinnern<br />
benutzt werden kann, delegiert <strong>Platon</strong> einfach an den verständigen Leser. <strong>Platon</strong><br />
liefert mit der Erfindung eines gelehrigen Sklaven nur einen Anlass und Anreiz für<br />
solche Überlegungen.)<br />
Der letztgenannte Punkt verdient einige zusätzliche Anmerkungen. Wenn man versucht,<br />
Passagen aus <strong>Platon</strong>s Dialogen in die Form eines <strong>Platon</strong>s Argumente systematisch<br />
entfaltenden Traktats zu bringen, stellt man häufig fest, dass man (zunächst) sehr wenig in<br />
der Hand hat. Aber man hat es doch mit dem göttlichen <strong>Platon</strong> (Stephen Clark) zu tun.<br />
Ganz so platt wie es dasteht kann es doch wohl nicht gemeint sein. Um sich nicht als<br />
schlicht dumm und/oder für die tiefsinnigen Gedanken <strong>Platon</strong>s unempfänglich zu outen,<br />
beginnt man also sich zu überlegen, welche tiefsinnigen Gedanken beim Abfassen der<br />
betreffenden Stellen <strong>Platon</strong> im Hinterkopf gehabt haben könnte. Man versteht Dialogpassagen<br />
als Stellvertreter für höchst subtile und tiefsinnige Überlegungen, (er-)findet<br />
neue, tiefer liegende Bedeutungsschichten des Dialogs und zieht letztlich auch andere<br />
Stellen aus anderen Dialogen hinzu. Das Spiel der <strong>Platon</strong> Exegese hat begonnen.<br />
Die Berge an <strong>Platon</strong> exegetischer Literatur sind nicht vorwiegend deswegen entstanden,<br />
weil <strong>Platon</strong> in knappster Form zwingende Argumente entwickelt, die man dann für<br />
Normalbegabte erst einmal ausführlich erläutern und kommentieren muss, sondern im<br />
Gegenteil, weil es <strong>Platon</strong> so häufig an eindeutigen und klaren Argumenten fehlen lässt, ist<br />
<strong>Platon</strong> so interpretations-bedürftig und für die aller verschiedensten Interpretationen<br />
zugänglich. <strong>Platon</strong> Exegese gleicht in vielerlei Hinsicht mehr der Deutung eines Stücks<br />
-47-