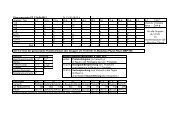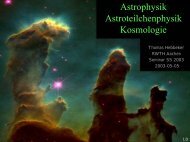Masterarbeit - Physikzentrum der RWTH Aachen
Masterarbeit - Physikzentrum der RWTH Aachen
Masterarbeit - Physikzentrum der RWTH Aachen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8. Fazit und Ausblick<br />
Im Laufe dieser Arbeit konnten die bestehenden PIN-Dioden-Verstärker so weit<br />
verbessert werden, dass 16 von ihnen stabil parallel betrieben werden können. Dies<br />
ist die Hauptvorraussetzung dafür, das Kalorimeter im Verbund des Flugzeitspektrometers<br />
während in eines Teststrahls einsetzen zu können. Hierfür musste die<br />
virtuelle Masse <strong>der</strong> Operationsverstärker durch einen zusätzlichen Kondensator für<br />
niedrigere Frequenzen vom Ausgangssignal entkoppelt werden. Um gemessene Daten<br />
auswerten zu können, muss eine absolute Kalibration <strong>der</strong> Kalorimeterzellen möglich<br />
sein. Es konnte an einer Kalorimeterzelle gezeigt werden, dass dies prinzipiell auch<br />
mit radioaktiven Quellen möglich ist. Zuverlässig, aber stärker mit systematischen<br />
Fehlern behaftet ist in diesem Fall jedoch die Kalibration durch kosmische Myonen.<br />
Durch eine detalliertere Simulation dieser Messung sollte eine exaktere Kalibration<br />
möglich sein. Dies muss aber nicht prinzipiell vor einem Strahlbetrieb geschehen,<br />
da während eines Strahlbetriebs alle Rohdaten gespeichert werden und nur für<br />
Einstellungs- und Überwachungszwecke eine vorläufige Kalibration nötig ist. Eine<br />
erneute Bearbeitung dieses Kalorimeters erübrigt sich unter Umständen, da bereits<br />
die nächste Iteration eines größeren Kalorimeters vorbereitet wird, welches später zur<br />
Messung von Wirkungsquerschnitten in einem Kohlenstoffstrahl verwendet werden<br />
soll. Für die Reduktion des Rauschens war zuerst eine eingehende Untersuchung<br />
desselben notwendig. Während dieses langwierigen Prozesses wurden Ursachen des<br />
Rauschens evaluiert, es wurde eine theoretische Beschreibung sämtlicher interner<br />
Rauschquellen aus <strong>der</strong> Literatur zusammengestellt und ein Verfahren zur numerischen<br />
Berechnung des Rauschen umgesetzt. Hierzu war eine vollständige Simulation <strong>der</strong><br />
Schaltkreise nötig, sodass das Spektrum <strong>der</strong> Quellen des Rauschen durch sämtliche<br />
Verstärkerstufen hindurch propagiert werden und anschließend auf den Eingang<br />
zurück projiziert werden konnte. Damit steht nun ein Instrument zur Verfügung, mit<br />
dem sich eine große Gruppe von zeitinvarianten ladungsempfindlichen Verstärkern<br />
auf die gleiche Art und Weise untersuchen lässt. Aus einer Reihe von Randbedingungen<br />
lassen sich Parameter einer geplanten Schaltung durch ein einfaches Verfahren<br />
optimieren, noch bevor ein Prototyp aufgebaut wird. Die Pulsform <strong>der</strong> Verstärker<br />
wurde so angepasst, dass ein stören<strong>der</strong> Überschwinger kompensiert wird. Dies ist<br />
notwendig, da die verwendeten Ladungskonverter keiner positiven Eingangsspannung<br />
ausgesetzt werden dürfen. Der positive Anteil <strong>der</strong> Pulse konnte leicht durch eine<br />
Pole-Zero-Kompensation unterdrückt werden. Weitere Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Pulsform<br />
lassen sich nun leicht mit Hilfe <strong>der</strong> Simulation evaluieren. Zusätzlich zur Simulation<br />
des Verstärkers in <strong>der</strong> Zeitbasis existieren nun Simulationen <strong>der</strong> Schleifenverstärkung<br />
83