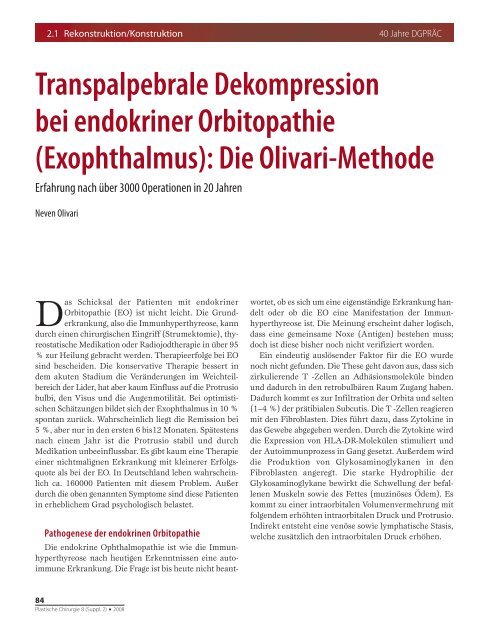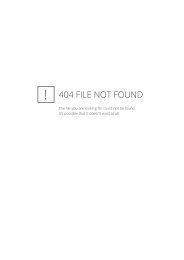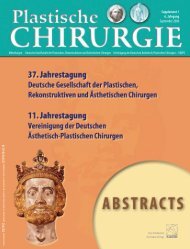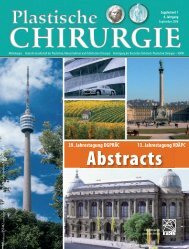Plastische Chirurgie 8: Supplement 2 (2008) - DGPRÄC
Plastische Chirurgie 8: Supplement 2 (2008) - DGPRÄC
Plastische Chirurgie 8: Supplement 2 (2008) - DGPRÄC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1 Rekonstruktion/Konstruktion 40 Jahre <strong>DGPRÄC</strong><br />
Transpalpebrale Dekompression<br />
bei endokriner Orbitopathie<br />
(Exophthalmus): Die Olivari-Methode<br />
Erfahrung nach über 3000 Operationen in 20 Jahren<br />
Neven Olivari<br />
Das Schicksal der Patienten mit endokriner<br />
Orbitopathie (EO) ist nicht leicht. Die Grund -<br />
erkrankung, also die Immunhyperthyreose, kann<br />
durch einen chirurgischen Eingriff (Strumektomie), thyreostatische<br />
Medikation oder Radiojodtherapie in über 95<br />
% zur Heilung gebracht werden. Therapieerfolge bei EO<br />
sind bescheiden. Die konservative Therapie bessert in<br />
dem akuten Stadium die Veränderungen im Weich teil -<br />
bereich der Lider, hat aber kaum Einfluss auf die Protrusio<br />
bulbi, den Visus und die Augenmotilität. Bei optimistischen<br />
Schätzungen bildet sich der Exophthalmus in 10 %<br />
spontan zurück. Wahrscheinlich liegt die Remission bei<br />
5 %, aber nur in den ersten 6 bis12 Monaten. Spätestens<br />
nach einem Jahr ist die Protrusio stabil und durch<br />
Medikation unbeeinflussbar. Es gibt kaum eine Therapie<br />
einer nichtmalignen Erkrankung mit kleinerer Erfolgs -<br />
quote als bei der EO. In Deutschland leben wahrscheinlich<br />
ca. 160000 Patienten mit diesem Problem. Außer<br />
durch die oben genannten Symptome sind diese Patienten<br />
in erheblichem Grad psychologisch belastet.<br />
Pathogenese der endokrinen Orbitopathie<br />
Die endokrine Ophthalmopathie ist wie die Immun -<br />
hyperthyreose nach heutigen Erkenntnissen eine autoimmune<br />
Erkrankung. Die Frage ist bis heute nicht beant-<br />
84<br />
<strong>Plastische</strong> <strong>Chirurgie</strong> 8 (Suppl. 2) � <strong>2008</strong><br />
wortet, ob es sich um eine eigenständige Erkrankung handelt<br />
oder ob die EO eine Manifestation der Immun -<br />
hyperthyreose ist. Die Meinung erscheint daher logisch,<br />
dass eine gemeinsame Noxe (Antigen) bestehen muss;<br />
doch ist diese bisher noch nicht verifiziert worden.<br />
Ein eindeutig auslösender Faktor für die EO wurde<br />
noch nicht gefunden. Die These geht davon aus, dass sich<br />
zirkulierende T -Zellen an Adhäsionsmoleküle binden<br />
und dadurch in den retrobulbären Raum Zugang haben.<br />
Dadurch kommt es zur Infiltration der Orbita und selten<br />
(1–4 %) der prätibialen Subcutis. Die T -Zellen reagieren<br />
mit den Fibroblasten. Dies führt dazu, dass Zytokine in<br />
das Gewebe abgegeben werden. Durch die Zytokine wird<br />
die Expression von HLA-DR-Molekülen stimuliert und<br />
der Autoimmunprozess in Gang gesetzt. Außerdem wird<br />
die Produktion von Glykosaminoglykanen in den<br />
Fibroblasten angeregt. Die starke Hydrophilie der<br />
Glykosaminoglykane bewirkt die Schwellung der befallenen<br />
Muskeln sowie des Fettes (muzinöses Ödem). Es<br />
kommt zu einer intraorbitalen Volumenvermehrung mit<br />
folgendem erhöhten intraorbitalen Druck und Protrusio.<br />
Indirekt entsteht eine venöse sowie lymphatische Stasis,<br />
welche zusätzlich den intraorbitalen Druck erhöhen.