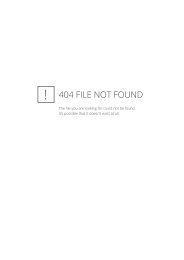2009 2010 - SPD
2009 2010 - SPD
2009 2010 - SPD
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
222 Bericht der Abgeordneten im Europaparlament<br />
Bericht der Abgeordneten im Europaparlament 223<br />
Bericht der <strong>SPD</strong>-Abgeordneten im Europäischen Parlament<br />
Neukonstituierung<br />
Am 7. Juni <strong>2009</strong> fanden die 7. Direktwahlen zum<br />
Europäischen Parlament statt. Trotz eines sehr<br />
engagierten und themenbezogenen <strong>SPD</strong>-Wahlkampfs,<br />
indem wir uns u. a. für die Einführung<br />
von Mindestlöhnen und eines stärker regulierten<br />
Finanzmarktes einsetzten – allen voran mit unserem<br />
Spitzenkandidaten Martin Schulz – war<br />
das Ergebnis letztendlich – nicht zuletzt aufgrund<br />
der niedrigen Wahlbeteiligung – enttäuschend.<br />
Auf die <strong>SPD</strong> entfielen lediglich 20,8 %<br />
der Stimmen. Dies hatte zur Folge, dass wir<br />
wieder nur mit 23 Abgeordneten ins Parlament<br />
einziehen konnten. Neben den 13 Kandidatinnen<br />
und Kandidaten, die wiedergewählt wurden,<br />
konnten wir erstmals 10 neue Kolleginnen und<br />
Kollegen in unseren Reihen begrüßen.<br />
Die sich neu konstituierte <strong>SPD</strong>-Delegation bestimmte<br />
am 15. September <strong>2009</strong> ihren Vorstand.<br />
Vorsitzender wurde erneut Bernhard Rapkay.<br />
Des Weiteren wurden Udo Bullmann, Constanze<br />
Krehl sowie Norbert Glante zu seinen Stellvertretern<br />
gewählt. Zur Schatzmeisterin wählten<br />
wir mit Jutta Steinruck eine neue Kollegin.<br />
Die Sozialdemokratische Fraktion, die sich mit<br />
Beginn der neuen Legislaturperiode nun Progressive<br />
Allianz der Europäischen Sozialdemokraten<br />
nennt (kurz S&D-Fraktion), wählte erneut<br />
Martin Schulz für zweieinhalb Jahre zu<br />
ihrem Vorsitzenden. Sie ist mit insgesamt 184<br />
Mitgliedern in der neuen Legislaturperiode die<br />
zweitstärkte Fraktion im Europäischen Parlament.<br />
Innerhalb der S&D-Fraktion stellt die <strong>SPD</strong>-Delegation<br />
mit 6 Koordinatorenposten den mit<br />
Abstand größten nationalen Anteil. So stammen<br />
für nachstehende Ausschüsse die Koordinatoren<br />
aus unseren Reihen:<br />
Die <strong>SPD</strong>-KoordinatorInnen<br />
Haushaltskontrollausschuss<br />
Jens Geier<br />
Ausschuss für Wirtschaft und Währung<br />
Udo Bullmann<br />
Ausschuss für Binnenmarkt<br />
und Verbraucherschutz<br />
Evelyne Gebhardt<br />
Ausschuss für regionale Entwicklung<br />
Constanze Krehl<br />
Ausschuss für Fischerei<br />
Ulrike Rodust<br />
Rechtsausschuss<br />
Bernhard Rapkay<br />
Auf institutioneller Ebene stellen wir mit Dagmar<br />
Roth-Behrendt eine Vizepräsidentin im Europäischen<br />
Parlament und mit Jo Leinen den Vorsitzenden<br />
des Ausschusses für Umweltfragen,<br />
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit.<br />
Europäische Bürgerinitiative<br />
Seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon<br />
am 01. Dezember <strong>2009</strong> gibt es die Möglichkeit<br />
einer Europäischen Bürgerinitiative, mit der Bürgerinnen<br />
und Bürger der EU sich direkt an der<br />
Europapolitik beteiligen können. Die Bürgerinitiative<br />
geht insoweit über das bereits bestehende<br />
Petitionsrecht beim Europäischen Parlament sowie<br />
das Beschwerderecht beim Europäischen<br />
Petitionsbeauftragten hinaus, als dass die Europäische<br />
Bürgerinitiative auf die Schaffung neuen<br />
EU-Rechts abzielt. Mit den bestehenden Instrumenten<br />
hingegen können nur Verstöße gegen<br />
geltendes EU-Recht angemahnt werden.<br />
Ab dem 01. April 2012 können Unionsbürger die<br />
EU-Kommission also auffordern, eine Gesetzesinitiative<br />
zu einem bestimmten Thema vorzulegen,<br />
das in den Kompetenzbereich der EU fällt.<br />
Zu diesem Zeitpunkt tritt nämlich die EU-Verordnung<br />
in Kraft, die die konkreten Bedingungen<br />
und Verfahrensvorschriften für die Bürgerinitiative<br />
festlegt. Sie wurde im Laufe des Jahres <strong>2010</strong><br />
zwischen dem Europäischen Parlament und dem<br />
Rat verhandelt. Den ersten Verordnungsentwurf<br />
legte die EU-Kommission am 31. März <strong>2010</strong> vor.<br />
In der Folgezeit fanden mehrere Verhandlungsrunden<br />
statt, die mit den Zustimmungen des<br />
Europaparlaments am 15. Dezember <strong>2010</strong> und<br />
des Rates am 13. Februar 2011 erfolgreich abgeschlossen<br />
werden konnten. Die verzögerte Geltung<br />
der Vorschriften zum 1. April 2012 wurde<br />
ausnahmsweise beschlossen, weil einige Mitgliedstaaten<br />
ihr innerstaatliches Recht ändern<br />
müssen, um beispielsweise gewährleisten zu<br />
können, dass etwaige Verstöße gegen die Verordnung<br />
auch sanktioniert werden.<br />
Um eine Europäische Bürgerinitiative zu starten,<br />
schreibt die Verordnung den Organisatoren vor,<br />
zunächst einen Bürgerausschuss zu bilden, dem<br />
mindestens sieben Bürger aus mindestens sieben<br />
verschiedenen Mitgliedstaaten angehören<br />
müssen. In einem von der EU-Kommission bereitgestellten<br />
Online-Register sind die geplanten<br />
Initiativen dann zu registrieren. Eine Registrierung<br />
darf nur verweigert werden, wenn die Initiative<br />
eindeutig gegen die grundlegenden Werte der<br />
EU gerichtet ist oder die Kommission den begehrten<br />
Rechtsakt nicht vorschlagen kann, weil sie<br />
dazu keine Kompetenz hätte. Nach der Registrierung<br />
haben die Initiatoren ein Jahr Zeit, um eine<br />
Million Unterschriften wahlberechtigter EU-Bürger<br />
zu sammeln, die wiederum aus mindestens<br />
einem Viertel der 27 Mitgliedstaaten (derzeit also<br />
aus 7) stammen müssen. Die EU-Kommission hat<br />
ihrerseits wiederum 3 Monate Zeit, um die Initiative<br />
zu prüfen. Im Anschluss hat sie 3 Möglichkeiten:<br />
Sie kann das Anliegen umsetzen, es<br />
abändern oder ablehnen. In diesem Fall muss<br />
sie die Entscheidung aber ausführlich begründen.<br />
Manche Voraussetzungen erscheinen auf den<br />
ersten Blick vielleicht als Hürde, sind aber vor<br />
dem Hintergrund zu sehen, dass das Ergebnis<br />
einer erfolgreichen Initiative EU-weit gelten soll.<br />
Die Mindestanforderungen im Hinblick auf die<br />
Anzahl der Unterstützer und die notwendige<br />
Beteiligung aus mehreren Mitgliedstaaten stellen<br />
zum Beispiel sicher, dass die Initiative von<br />
Beginn an europaweit eine breite Unterstützung<br />
und Akzeptanz genießt.<br />
Bei den Verhandlungen haben wir Sozialdemokratinnen<br />
und Sozialdemokraten darauf hingewirkt,<br />
dass zu weit gehende Hindernisse abgebaut<br />
wurden, damit sich alle Bürgerinnen und<br />
Bürger so unbürokratisch wie möglich beteiligen<br />
können. So konnten wir erfolgreich durchsetzen,<br />
dass die Zulässigkeit einer Initiative bereits<br />
bei der Registrierung geprüft wird und nicht –<br />
wie ursprünglich vorgesehen – nachdem bereits<br />
300.000 Unterschriften gesammelt wurden. Der<br />
bis zu diesem Zeitpunkt investierte zeitliche und<br />
finanzielle Aufwand wäre im Falle der nachträglich<br />
festgestellten Unzulässigkeit andernfalls<br />
schlicht umsonst gewesen. Außerdem wäre das<br />
Engagement für weitere Bürgerinitiativen damit<br />
vermutlich gebremst worden.<br />
Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass Initiativen<br />
organisatorisch und finanziell von juristischen<br />
Personen wie Parteien, NGOs oder<br />
Verbänden unterstützt werden können, sofern<br />
dies transparent gemacht wird. Mit der Möglichkeit,<br />
auf die Erfahrungen und Netzwerke dieser<br />
Gruppen zurückgreifen zu können, wird es den<br />
Organisatoren erheblich erleichtert, ihre Initiative<br />
zum Erfolg zu führen.<br />
Vereinbart wurde ferner, einige Durchführungsbestimmungen<br />
den Mitgliedstaaten zu überlassen:<br />
Hierzu gehört das Mindestalter für die<br />
Beteiligung, wobei das Wahlalter bei Europawahlen<br />
zur Orientierung dienen soll. Das entspricht<br />
einem Mindestalter von 18 Jahren in sämtlichen<br />
Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Österreich,<br />
wo man bereits mit 16 an den Wahlen zum Europäischen<br />
Parlament teilnehmen kann. Außerdem<br />
wurde die Frage, ob zur Verifizierung der<br />
Unterschriften die Angabe von Ausweisnummern<br />
erforderlich ist oder nicht, den Mitgliedstaaten<br />
überlassen.<br />
<strong>SPD</strong>-Jahrbuch <strong>2009</strong> • <strong>2010</strong><br />
Ein weiterer Verhandlungserfolg ist die Verpflichtung<br />
der EU-Kommission, innerhalb von 6 Monaten<br />
nach Inkrafttreten der Verordnung eine<br />
Open-source-Software zur Verfügung zu stellen,<br />
die die Organisatoren für die Online-Sammlung<br />
von Unterschriften nutzen können. Dies vereinfacht<br />
die Unterschriftensammlung ungemein.<br />
Schließlich wurde den Organisatoren ein Anspruch<br />
zugestanden, mit dem sie öffentliche<br />
Anhörungen durch das Europaparlament und die<br />
EU-Kommission einfordern können. Auf diesem<br />
Wege können sie mehr öffentliche Aufmerksamkeit<br />
für die Initiative erreichen.<br />
Mit der Europäischen Bürgerinitiative haben wir<br />
ein wichtiges Instrument zur intensiven Bürgerbeteiligung<br />
etabliert, die unerlässlich für eine<br />
lebendige Demokratie ist. Sie wird dazu beitragen,<br />
dass die Menschen ein größeres Interesse<br />
dafür entwickeln, was in der Europapolitik, die<br />
ja vielfach noch immer als abstrakt wahrgenommen<br />
wird, passiert. Im Rahmen der Europäischen<br />
Bürgerinitiativen werden grenzüberschreitende<br />
Debatten über wichtige europäische Themen<br />
geführt werden. Dies wird wiederum dazu führen,<br />
dass Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern<br />
näher gebracht wird und sie Europapolitik<br />
künftig selbst in die Hand nehmen.<br />
Finanzmarktpolitik <strong>2009</strong>-<strong>2010</strong><br />
Was 2007 zunächst mit einer Krise am US-Immobilienmarkt<br />
begann, führte beinahe zum<br />
Zusammenbruch des globalen Finanzsystems.<br />
Das Ausmaß und die Reichweite der Wirtschafts-<br />
und Finanzkrise übertraf alle anderen<br />
ökonomischen Krisen der letzten Jahrzehnte.<br />
Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Hauptsächlich<br />
sind jedoch die Deregulierung der Finanzmärkte<br />
sowie die Schaffung neuer, hochriskanter<br />
Spekulationsinstrumente zu nennen, die als<br />
Anreiz für kurzfristige, hochspekulative Transaktionen<br />
dienten. Im Vordergrund stand nicht<br />
das nachhaltige Wirtschaften, sondern der<br />
schnelle Profit. Der Drang der Finanzmarktakteure<br />
nach Rendite stieg dramatisch an. Finanzinvestitionen<br />
wurden massiv ausgeweitet<br />
und die Realinvestitionen zurückgefahren. Dies<br />
führte dazu, dass der Wert aller Finanztransaktionen<br />
in den Industrieländern teilweise mehr<br />
als das Hundertfache des nominellen Bruttoinlandsproduktes<br />
betrug. Der verstärkten Risikoneigung<br />
der Akteure auf den Finanzmärkten<br />
stand das fehlende ordnungspolitische Korrektiv<br />
in Form von effektiven Finanzmarktregeln<br />
gegenüber. Auf nationaler Ebene ließen sich<br />
hierfür keine überzeugenden Lösungen schaffen,<br />
denn der Finanzsektor agiert global. Aus<br />
diesem Grund musste die EU reagieren und<br />
der Beseitigung der Missstände im Finanzsektor<br />
oberste Priorität einräumen. Viele Vorschläge<br />
zur nachhaltigen Regulierung der Branche,<br />
<strong>SPD</strong>-Jahrbuch <strong>2009</strong> • <strong>2010</strong><br />
die Sozialdemokraten schon seit langem gemacht<br />
hatten, wurden endlich Realität:<br />
Regulierung alternativer Investmentfonds<br />
Die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament<br />
setzt sich bereits seit 2002 mit Nachdruck<br />
für eine umfassende Regulierung von Hedge<br />
Fonds und privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften<br />
ein. Die EU-Kommission hatte sich jedoch<br />
lange Zeit vehement geweigert, überhaupt<br />
aktiv zu werden. Eine Regulierung sei nicht nötig,<br />
nicht möglich und ohnehin kontraproduktiv. Erst<br />
angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie<br />
des wachsenden öffentlichen Drucks sah sich<br />
die Kommission <strong>2009</strong> zum Handeln gezwungen.<br />
Die Richtlinie über Verwalter alternativer Investmentfonds<br />
(darunter fallen insbesondere<br />
Manager von Hedge Fonds und privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften<br />
auch Private Equity<br />
genannt) soll für mehr Transparenz und eine<br />
bessere Aufsicht sorgen. Gleichzeitig erhalten<br />
institutionelle Anleger (etwa Pensionsfonds oder<br />
Versicherungsunternehmen) aber auch mittelständische<br />
Unternehmen und ihre Beschäftigten<br />
mehr Sicherheit. Erstmals gibt es überhaupt<br />
eine Regulierung von alternativen Investmentfondsmanagern.<br />
Diese müssen sich zukünftig<br />
bei den zuständigen nationalen Behörden registrieren<br />
lassen. Verwalten sie ein Fondsvermögen<br />
von über 100 Mio. Euro (Hedge Fonds) beziehungsweise<br />
500 Mio. Euro (Private Equity) fallen<br />
sie ausnahmslos unter die Richtlinie und müssen<br />
ihre Strategien sowie die damit verbundenen<br />
Risiken offenlegen. Im Gegenzug erhalten<br />
sie ab 2013 einen Pass, der ihnen die Vermarktung<br />
der Fonds in der gesamten EU erlaubt.<br />
Fondsmanager aus Drittstaaten können sich<br />
ab 2015 entweder ebenfalls dem EU-Regime unterstellen<br />
und einen europäischen Pass für die<br />
Vermarktung erhalten oder sich in den Mitgliedstaaten<br />
registrieren lassen, in denen sie<br />
aktiv werden wollen. Ab 2018 soll es dann keine<br />
nationalen Zulassungen mehr, sondern nur<br />
noch den europäischen Pass für alle geben. Dadurch<br />
sinkt die Gefahr der Regulierungsarbitrage<br />
und eines damit verbundenen Wettlaufs um<br />
die niedrigsten Aufsichtsstandards. Auf Druck<br />
der sozialdemokratischen Fraktion und gegen<br />
große Widerstände im Ministerrat wurden erstmals<br />
europäische Vorschriften gegen das Ausplündern<br />
übernommener Unternehmen (Asset<br />
Stripping) erlassen. Die Substanz der Unternehmen<br />
ist nun für zwei Jahre geschützt. Gleichzeitig<br />
erhalten Beschäftigte von nicht börsennotierten<br />
Unternehmen im Falle von Übernahmen<br />
durch alternative Investmentfonds mehr Informationen.<br />
Ein noch umfassenderer Schutz ist am<br />
Widerstand der EU-Mitgliedstaaten gescheitert.<br />
Dafür ist neben Großbritannien nicht zuletzt die<br />
deutsche Bundesregierung verantwortlich. Die<br />
Richtlinie definiert in diesem Punkt jedoch nur<br />
Mindestanforderungen. Es steht den Mitglied-<br />
Die Gruppe der Abgeordneten <strong>2009</strong><br />
staaten daher frei, bei der Umsetzung weiterreichende<br />
Regeln zum Schutz übernommener<br />
Unternehmen zu formulieren. Weitere Schwerpunkte<br />
sind unter anderem: die Transparenz der<br />
Manager und ihrer Arbeit (mehr Informationen<br />
an Behörden und Investoren); die Delegation von<br />
Aufgaben (keine endlosen Delegationsketten);<br />
die ordnungsgemäße Verwahrung des Fondsvermögens<br />
(klare Zuständigkeit muss gewahrt<br />
bleiben); Obergrenzen bei der Verschuldung<br />
(selbst gesetzt, aber einschließlich der Möglichkeit<br />
der Behörden im Gefahrenfall andere Limits<br />
zu setzen).<br />
Ratingagenturen<br />
Das Europäische Parlament hat <strong>2009</strong> und <strong>2010</strong><br />
mit großer Mehrheit wichtige Weichen zur Regulierung<br />
von Ratingagenturen gestellt. Ratingagenturen<br />
genießen in Zukunft keinen Freifahrtschein<br />
mehr, sondern müssen sich den<br />
EU-Aufsichtsregeln unterstellen, wenn sie in<br />
Europa arbeiten wollen. Im Mittelpunkt stehen<br />
mehr Verantwortung und Transparenz. Die gleichzeitige<br />
Beratung eines Kunden und Bewertung<br />
seiner Produkte ist nicht mehr erlaubt. Um Interessenkonflikte<br />
zu vermeiden, sind die Ratingagenturen<br />
angehalten, einen Verhaltenskodex<br />
zu entwickeln, den sie bei der Registrierung präsentieren<br />
müssen. Des Weiteren sieht die neue<br />
Verordnung vor, dass die Analysten der Ratingagenturen<br />
alle 4 bis 5 Jahre ihr Aufgabengebiet<br />
wechseln müssen.<br />
Eigenkapitalausstattung von Banken (CRD III)<br />
Banken müssen gemäß der EU-Eigenkapitalrichtlinien<br />
(Capital Requirement Directive – CRD III)<br />
ab 2012 höhere Eigenkapitalquoten für risikoreiche<br />
Geschäfte vorweisen (Positionen im Handelsbuch<br />
sowie Weiterverbriefungen). Außerdem<br />
sollen unangemessene Vergütungen ein<br />
Ende haben. Ab 2011 müssen 40 % der Boni einbehalten<br />
werden und die mittelfristige Entwicklung<br />
des Unternehmens entscheidet über<br />
die spätere Auszahlung. Darüber hinaus sollen<br />
staatlich unterstützte Banken in der Regel keine<br />
Manager-Boni mehr zahlen dürfen. Anfang Mai<br />
<strong>2009</strong> beschloss das Europäische Parlament bereits<br />
eine Verschärfung der bestehenden Eigenkapitalrichtlinien<br />
(CRD II). Dazu zählt ein Min





![Gesamter Wortlaut der Rede von Sigmar Gabriel [PDF] - SPD](https://img.yumpu.com/22803291/1/184x260/gesamter-wortlaut-der-rede-von-sigmar-gabriel-pdf-spd.jpg?quality=85)
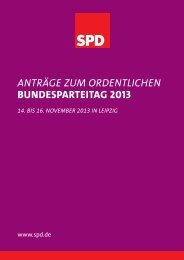

![Beschlussbuch [ PDF , 4,6 MB ] - SPD](https://img.yumpu.com/21925732/1/184x260/beschlussbuch-pdf-46-mb-spd.jpg?quality=85)
![Antragsbuch [ PDF , 161 kB ] - SPD](https://img.yumpu.com/21902361/1/184x260/antragsbuch-pdf-161-kb-spd.jpg?quality=85)

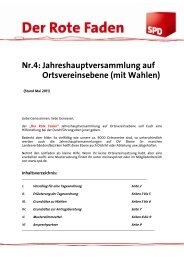

![Protokoll [ PDF , 2 MB] - SPD](https://img.yumpu.com/15086716/1/184x260/protokoll-pdf-2-mb-spd.jpg?quality=85)