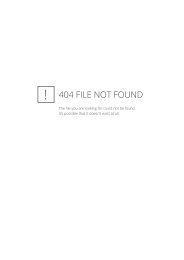2009 2010 - SPD
2009 2010 - SPD
2009 2010 - SPD
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
230 Kommunalpolitik Bundes-SGK<br />
Kommunalpolitik Bundes-SGK 231<br />
Neben der Prüfung der bestehende Praxis zur<br />
Beteiligung der Kommunen an der Gesetzgebung<br />
des Bundes sowie an der EU-Rechtsetzung<br />
und von Standards mit finanziellen Auswirkungen<br />
auf die Kommunen, sollte in der<br />
Gemeindefinanzkommission insbesondere das<br />
Modell der FDP, Ersatz der Gewerbesteuer durch<br />
einen höheren Anteil der Kommunen an der<br />
Um satzsteuer sowie einem Hebesatz auf die<br />
Einkommen- und Körperschaftssteuer, untersucht<br />
werden. Den Kommunalen Spitzenverbänden<br />
ist es zudem gelungen, in der Gemeindefinanzkommission<br />
das so genannte Kommunalmodell<br />
beraten zu lassen.<br />
Joachim Poß, MdB, stellv. Vorsitzender der <strong>SPD</strong>-Bundestagsfraktion,<br />
mit dem Gesprächskreis „Kommunale Spitzenverbände<br />
/ Bundes-SGK“ im September <strong>2010</strong><br />
München und Präsident des Deutschen Städtetages<br />
Manuela Schwesig auf der Delegiertenversammlung<br />
der Bundes-SGK im November <strong>2010</strong> in Bremen<br />
Foto: <strong>SPD</strong>-Bundestagsfraktion<br />
Foto: Bundes-SGK / L. Richter<br />
Foto: Bundes-SGK / F. Strangmann<br />
Der <strong>SPD</strong>-Parteivorstand hatte im August <strong>2010</strong><br />
auf Initiative der Bundes-SGK eine Resolution<br />
zur Verbesserung der Kommunalfinanzen beschlossen:<br />
„Die Gewerbesteuer muss durch eine<br />
Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen und<br />
die Einbeziehung von Selbstständigen und Freiberuflern<br />
gestärkt werden, so wie dies auch das<br />
Kommunalmodell der Kommunalen Spitzenverbände<br />
vorsieht.“ Zudem fordert die <strong>SPD</strong>, die<br />
derzeitigen Regelungen zur Finanzierung der<br />
Kosten für die Grundsicherung im Alter sowie<br />
die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II und<br />
die Mitfinanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung<br />
durch den Bund in der Gemeindefinanzkommission<br />
einer eingehenden Prüfung<br />
zu unterziehen.<br />
Der Vorstand der Bundes-SGK legte zur Delegiertenversammlung<br />
am 12. / 13. November <strong>2010</strong> einen<br />
Antrag zur Verbesserung der Kommunalfinanzen<br />
vor, der neben der Stärkung der Einnahmebasis<br />
der Kommunen konkrete Vorschläge zur Reduzierung<br />
der hohen Belastungen der Kommunen<br />
von Sozialausgaben vorsieht, insbesondere<br />
durch die Übernahme der Grundsicherung im<br />
Alter durch den Bund.<br />
Am 15. Juni 2011 wurde in der letzten Sitzung der<br />
Gemeindefinanzkommission das FDP-Modell als<br />
untauglich mehrheitlich verworfen. Auch der<br />
noch mit den Kommunalen Spitzenverbänden<br />
in einem Gespräch im November <strong>2010</strong> erörterte<br />
Vorschlag des Bundesfinanzministers, einen Zuschlag<br />
(Hebesatzrecht) auf die Einkommensteuer<br />
durch die Kommunen erheben zu können, fand in<br />
der Gemeindefinanzkommission keine Mehrheit.<br />
Ein großer Erfolg bleibt für die Kommunen die<br />
vollständige Übernahme der Grundsicherung im<br />
Alter durch den Bund ab 2014. Diese bereits im<br />
Vermittlungsverfahren zum SGB II Anfang 2011<br />
getroffene Vereinbarung, für die sich die Bundes-<br />
SGK und die <strong>SPD</strong> in Übereinstimmung mit den<br />
Kommunalen Spitzenverbänden eingesetzt hatten,<br />
hat die Gemeindefinanzkommission noch<br />
einmal bestätigt.<br />
Angesichts des ursprünglichen Vorhabens der<br />
schwarz-gelben Koalition bei der Einsetzung der<br />
Gemeindefinanzkommission haben die Kommunen<br />
viel erreicht: Die Gewerbesteuer ist gerettet,<br />
es gibt keinen Zuschlag auf die Einkommensteuer<br />
und die Grundsicherung im Alter<br />
wird vom Bund übernommen.<br />
Zukunft der Jobcenter<br />
und des Optionsmodells gesichert<br />
Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom<br />
20. Dezember 2007 wurden mehr als zwei Jahre<br />
lang unterschiedliche Modelle für die Organisation<br />
der Arbeitsmarktpolitik in Arbeitsgemeinschaften<br />
und im Optionsmodell diskutiert. Der<br />
Durchbruch wurde erst am 24. März <strong>2010</strong> erreicht,<br />
als die Bundesministerin für Arbeit, die<br />
Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen der <strong>SPD</strong><br />
und der CDU / CSU und FDP sowie die Minister-<br />
präsidenten der Bundesländer Rheinland-Pfalz<br />
und Sachsen dem Kompromiss der Bund-Länder-<br />
Arbeitsgruppe vom 20. März <strong>2010</strong> zustimmten.<br />
Mit diesem Kompromiss konnte die Absicherung<br />
der Arbeitsgemeinschaft als gemeinsame<br />
Einrichtung und das Optionsmodell im Grundgesetz<br />
erreicht werden. Zudem wurde vereinbart,<br />
dass die Zahl der Optionskommunen auf<br />
25 %, also auf derzeit 110 der in Frage kommenden<br />
kommunalen Träger ausgedehnt werden kann.<br />
Dieser Vereinbarung wurde vor der Sommerpause<br />
<strong>2010</strong> durch Bundestag und Bundesrat zugestimmt.<br />
Kommunen fördern Bildung und Teilhabe von<br />
Kindern und Jugendlichen im SGB II-Bezug<br />
Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar<br />
<strong>2010</strong> den Bundesgesetzgeber zur Sicherstellung<br />
einer ausreichenden soziokulturellen Teilhabe<br />
von Kindern und Jugendlichen im SGB II-Bezug<br />
und einer sachgerechten Ermittlung der Regelsätze<br />
aufgefordert. Da die Umsetzung durch die<br />
Bundesarbeitsministerin völlig unzureichend war,<br />
erfolgte im Winter <strong>2010</strong>/2011 ein zehnwöchiges<br />
Vermittlungsverfahren, an dessen Ende am 25.<br />
Februar 2011 folgende Ergebnisse standen:<br />
Die <strong>SPD</strong> konnte erreichen, dass das Bildungs-<br />
und Teilhabepaket an die Kommunen übertragen<br />
wird, wie dies auch von den Kommunalen Spitzenverbänden<br />
in Verbindung mit einer auskömmlichen<br />
Finanzierung gefordert worden war. Damit<br />
können die Kommunen ihre vielfältigen kommunalen<br />
Teilhabemaßnahmen sichern und ausbauen<br />
und ihre reichhaltigen Erfahrungen aus<br />
der Kinder- und Jugendhilfearbeit zur Verbesserung<br />
der Teilhabechancen einbringen. Auch<br />
konnte die <strong>SPD</strong> erreichen, dass Kinder von Geringverdienern,<br />
die Wohngeld und den Kinderzuschlag<br />
beziehen, ebenfalls die Leistungen des<br />
Bildungs- und Teilhabepakets in Anspruch nehmen<br />
können. Insbesondere wurde auch auf<br />
massiven Druck von <strong>SPD</strong> und Bundes-SGK eine<br />
auskömmliche Finanzierung der Bildungs- und<br />
Teilhabeleistungen und eine Revisionsklausel<br />
erreicht, die sicherstellen, dass die Kommunen<br />
die ihnen durch die Übertragung des Bildungs-<br />
und Teilhabepakets entstehenden Kosten auch<br />
zeitnah erstattet bekommen.<br />
Zudem ist es <strong>SPD</strong> und Bundes-SGK gelungen,<br />
in diesem Vermittlungsverfahren die Entlastung<br />
der Kommunen von der Grundsicherung im<br />
Alter zu erreichen, ohne dass an diese Entlastungen<br />
durch den Bund Bedingungen geknüpft<br />
worden sind. Die Kommunen werden in<br />
3 Stufen (2012 zu 45 %, 2013 zu 75 %, ab 2014 zu<br />
100 %) vollständig von den Kosten der Grundsicherung<br />
im Alter ohne Vorbedingungen entlastet;<br />
dies bedeutet Entlastungen in 2012 von<br />
rund 1,2 Mrd. Euro, in 2013 von rund 2,7 Mrd.<br />
Euro und ab 2014 von rund 4 Mrd. Euro jährlich<br />
mit steigender Tendenz.<br />
<strong>SPD</strong>-Jahrbuch <strong>2009</strong> • <strong>2010</strong><br />
Ausbau Kinderbetreuung:<br />
Kommunen fordern „Krippengipfel“<br />
Damit die Kommunen ab 2013 den sinnvollen<br />
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für<br />
Kinder zwischen ein und 3 Jahren (U3-Betreuung)<br />
erfüllen können, muss – so die Position der<br />
Bundes-SGK – die derzeitige Mitfinanzierung<br />
des Ausbaus der frühkindlichen Erziehung und<br />
Kinderbetreuung durch Bund und Länder ausgeweitet<br />
werden. Die dem Bund-Länder-Kompromiss<br />
zugrunde gelegten Rahmendaten entsprechen<br />
nicht mehr der Realität; die Kosten für<br />
den Ausbau der U3-Betreuung sind höher und<br />
der Bedarf an frühkindlicher Betreuung geht<br />
weit über die 35 %-Quote hinaus. Der amtierende<br />
Vorsitzende der Bundes-SGK, Stephan Weil, forderte<br />
daher einen gemeinsamen Krippengipfel,<br />
um auf der Grundlage realistischer Zahlen eine<br />
stärkere Unterstützung seitens des Bundes zu<br />
vereinbaren. Ansonsten kann der Rechtsanspruch<br />
auf einen Betreuungsplatz im Jahr 2013 nicht<br />
erfüllt werden.<br />
Rettet die gesamte Städtebauförderung<br />
Der Vorstand der Bundes-SGK hatte sich erstmalig<br />
in seinem Beschluss vom 17. September<br />
<strong>2010</strong> entschieden gegen die von der Bundesregierung<br />
geplante Kürzung der Städtebauförderungsmittel<br />
des Bundes ab 2011 ausgesprochen.<br />
Er plädierte in Übereinstimmung mit der Bauministerkonferenz<br />
für den Erhalt der Städtebau-<br />
förderung mindestens auf dem bisherigen Niveau<br />
von 610 Millionen Euro. Zudem wurden die<br />
Bundesländer aufgefordert, sich weiterhin für<br />
den Erhalt sämtlicher Städtebauförderungsmittel<br />
einzusetzen und die eigenen Kofinanzierungsanteile<br />
entsprechend in den Länderhaushalten<br />
bereit zu stellen.<br />
Nach den skandalösen Kürzungen des Programms<br />
„Soziale Stadt“ auf einen Restbetrag von 28,5 Mio.<br />
Euro und der gesamten Städtebauförderung auf<br />
455 Mio. Euro im Bundeshaushalt 2011 hat die<br />
Bundesregierung mit den von ihr beschlossenen<br />
Eckpunkten für den Haushalt 2012 weitere Kürzungen<br />
in den Städtebauförderungsprogrammen<br />
vorgesehen. Hiergegen wendet sich das<br />
anlässlich der Preisverleihung Preis Soziale Stadt<br />
<strong>2010</strong> gegründete Bündnis für eine soziale Stadt<br />
dem die Auslober des Wettbewerbes, der AWO<br />
Bundesverband, der Deutschen Städtetag, der<br />
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und<br />
Immobilienunternehmen, die GBG Mannheimer<br />
Wohnungsbaugesellschaft, die Schader-Stiftung<br />
und der vhw Bundesverband für Wohnen und<br />
Stadtentwicklung angehören. Die Bundes-SGK<br />
wirbt bei den Kommunen um weitere Unterstützung<br />
des Bündnisses.<br />
Sozialdemokratische Stadtentwicklungspolitik<br />
Nach den Beschlüssen der Delegiertenversammlung<br />
<strong>2009</strong> zur sozialen Stadt, zur Energie- und<br />
<strong>SPD</strong>-Jahrbuch <strong>2009</strong> • <strong>2010</strong><br />
Klimaschutzpolitik und zur Sicherung der Daseinsvorsorge<br />
in strukturschwachen ländlichen<br />
Räumen legte der Vorstand der Bundes-SGK zur<br />
Delegiertenversammlung einen Antrag zur sozialdemokratischen<br />
Stadtentwicklungspolitik vor,<br />
der mit großer Mehrheit beschlossen wurde. In<br />
diesem Beschluss werden für zentrale Handlungsfelder<br />
der Stadtentwicklung, angefangen<br />
von der lokalen Integrationspolitik über Konzepte<br />
der Sozialen Stadt, neue Formen der Mobilität<br />
bis hin zu einer Wohnungspolitik, sozialdemokratische<br />
Antworten gegeben. Dieses Positionspapier<br />
diente auch als Grundlage für die Beratungen<br />
auf der Fachkonferenz Zukunft Stadt der<br />
Bundes-SGK am 1. / 2. Juli 2011 in Berlin.<br />
Fachkonferenz<br />
Kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik<br />
Am 13. März <strong>2009</strong> haben sich KommunalpolitikerInnen,<br />
hochrangige VertreterInnen der kommunalen<br />
Wirtschaft und deren Berater in Mainz<br />
auf einer Fachkonferenz der Bundes-SGK mit den<br />
Möglichkeiten einer integrierten kommunalen<br />
Energie- und Klimaschutzpolitik auseinander gesetzt.<br />
Hauptredner der Fachkonferenz waren der<br />
damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel<br />
und seine Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz<br />
Margit Conrad. Klimaschutz- und Energiepolitik<br />
lassen sich nicht trennen, so die zentrale Aussage<br />
der Konferenz. Mit den Zielen der Klimaschutzpolitik<br />
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, wie<br />
sie durch die EU und die Bundesregierung vorgegeben<br />
worden sind, geht die Notwendigkeit<br />
einer veränderten Energiepolitik einher. Zentrale<br />
Themen der Veranstaltung waren der verbesserte<br />
Technologieeinsatz in neuen Kraftwerken<br />
und der massive Ausbau erneuerbarer Energien,<br />
die Steigerung der Energieeffizienz in Produktion<br />
und Verbrauch sowie die Erhöhung des Anteils<br />
der Kraft-Wärme-Koppelung.<br />
Zudem wurden Maßnahmen der kommunalen<br />
Energie- und Klimaschutzpolitik erörtert, wie z. B.<br />
die energetische Gebäudesanierung sowie der<br />
Ausbau der Energieerzeugung durch kommunale<br />
Unternehmen. Damit verbunden wurde auch<br />
die Frage erörtert, unter welchen Umständen es<br />
sinnvoll ist, sich sowohl im Bereich der Verteilung<br />
als auch im Bereich der Erzeugung stärker zu<br />
engagieren und eigenständige kommunale Versorgungsstrukturen<br />
aufzubauen.<br />
Kommunalisierung<br />
von Strom- und Gasverteilnetzen<br />
In zahlreichen Städten, Gemeinden und Kreisen<br />
laufen in den nächsten Jahren die vertraglichen<br />
Bindungen mit den Unternehmen in verschiedenen<br />
Sparten der kommunalen Daseinsvorsorge<br />
aus. Dabei handelt es sich insbesondere um<br />
auslaufende Konzessionsverträge im Bereich der<br />
Verteilnetze der Energieversorgung. Daraus resultiert<br />
in vielen Kommunen eine Diskussion<br />
Foto: Bundes-SGK / P. Hamon<br />
Foto: Bundes-SGK / L. Richter<br />
darüber, welche Vorteile eine Kommunalisierung<br />
der Aufgabenerledigung mit einem eigenen kommunalen<br />
Unternehmen oder in Partnerschaft<br />
mit anderen kommunalen oder privaten Unternehmen<br />
bietet.<br />
Die Bundes-SGK hat hierzu eine Handreichung<br />
in der Reihe Argumente veröffentlicht. Auch der<br />
Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat<br />
gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag (DST)<br />
und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund<br />
(DStGB) eine detailliertere Broschüre Konzes-<br />
sionsverträge – Handlungsoptionen für Kommunen<br />
und Stadtwerke herausgegeben. Mit<br />
seiner Dokumentation Nr. 97 hat der Deutsche<br />
Städte- und Gemeindebund eine weitere Broschüre<br />
zur Frage des Umgangs mit auslaufenden<br />
Konzessionsverträgen veröffentlicht. Die<br />
Argumente und Broschüren helfen kommunalen<br />
Entscheidungsträgern, den Prozess der Neu-<br />
Konzessionierung richtig zu strukturieren und<br />
weisen auf die möglichen Handlungsalternativen<br />
anhand von Beispielen hin.<br />
Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg,<br />
Stellvertreter der Präsidentin des Deutschen Städtetages<br />
und Mitglied im <strong>SPD</strong>-Parteivorstand, Jens Böhrnsen,<br />
Stephan Weil und Detlef Raphael<br />
Sigmar Gabriel und Roland Schäfer, Bürgermeister der<br />
Stadt Bergkamen, Präsident des Deutschen Städte- und<br />
Gemeindebundes, bei der Fachkonferenz „Kommunale<br />
Energie- und Klimaschutzpolitik“ am 13.03.<strong>2009</strong> in Mainz





![Gesamter Wortlaut der Rede von Sigmar Gabriel [PDF] - SPD](https://img.yumpu.com/22803291/1/184x260/gesamter-wortlaut-der-rede-von-sigmar-gabriel-pdf-spd.jpg?quality=85)
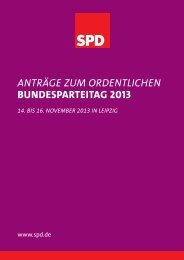

![Beschlussbuch [ PDF , 4,6 MB ] - SPD](https://img.yumpu.com/21925732/1/184x260/beschlussbuch-pdf-46-mb-spd.jpg?quality=85)
![Antragsbuch [ PDF , 161 kB ] - SPD](https://img.yumpu.com/21902361/1/184x260/antragsbuch-pdf-161-kb-spd.jpg?quality=85)

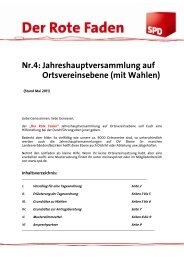

![Protokoll [ PDF , 2 MB] - SPD](https://img.yumpu.com/15086716/1/184x260/protokoll-pdf-2-mb-spd.jpg?quality=85)