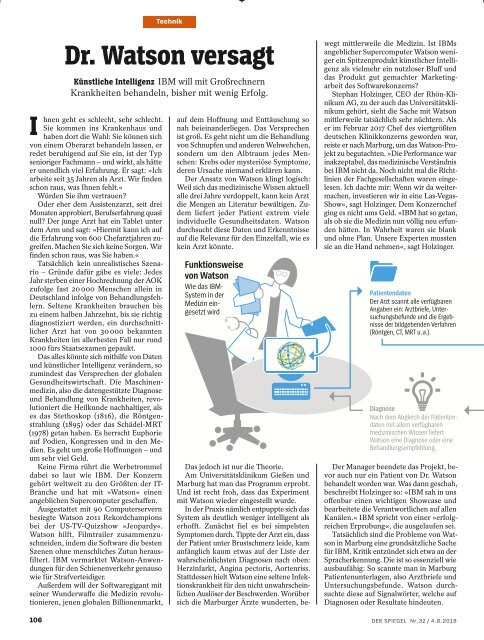Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Technik<br />
Dr. Watson versagt<br />
Künstliche Intelligenz IBM will mit Großrechnern<br />
Krankheiten behandeln, bisher mit wenig Erfolg.<br />
I<br />
hnen geht es schlecht, sehr schlecht.<br />
Sie kommen ins Krankenhaus und<br />
haben dort die Wahl: Sie können sich<br />
von einem Oberarzt behandeln lassen, er<br />
redet beruhigend auf Sie ein, ist der Typ<br />
senioriger Fachmann – und wirkt, als hätte<br />
er unendlich viel Erfahrung. Er sagt: »Ich<br />
arbeite seit 35 Jahren als Arzt. Wir finden<br />
schon raus, was Ihnen fehlt.«<br />
Würden Sie ihm vertrauen?<br />
Oder eher dem Assistenzarzt, seit drei<br />
Monaten approbiert, Berufserfahrung quasi<br />
null? <strong>Der</strong> junge Arzt hat ein Tablet unter<br />
dem Arm und sagt: »Hiermit kann ich auf<br />
die Erfahrung von 600 Chefarztjahren zugreifen.<br />
Machen Sie sich keine Sorgen. Wir<br />
finden schon raus, was Sie haben.«<br />
Tatsächlich kein unrealistisches Szenario<br />
– Gründe dafür gäbe es viele: Jedes<br />
Jahr sterben einer Hochrechnung der AOK<br />
zufolge fast 20 000 Menschen allein in<br />
Deutschland infolge von Behandlungsfehlern.<br />
Seltene Krankheiten brauchen bis<br />
zu einem halben Jahrzehnt, bis sie richtig<br />
diagnostiziert werden, ein durchschnitt -<br />
licher Arzt hat von 30 000 bekannten<br />
Krankheiten im allerbesten Fall nur rund<br />
1000 fürs Staatsexamen gepaukt.<br />
Das alles könnte sich mithilfe von Daten<br />
und künstlicher Intelligenz verändern, so<br />
zumindest das Versprechen der globalen<br />
Gesundheitswirtschaft. Die Maschinen -<br />
medizin, also die datengestützte Diagnose<br />
und Behandlung von Krankheiten, revolutioniert<br />
die Heilkunde nachhaltiger, als<br />
es das Stethoskop (1816), die Röntgenstrahlung<br />
(1895) oder das Schädel-MRT<br />
(1978) getan haben. Es herrscht Euphorie<br />
auf Podien, Kongressen und in den Medien.<br />
Es geht um große Hoffnungen – und<br />
um sehr viel Geld.<br />
Keine Firma rührt die Werbetrommel<br />
dabei so laut wie IBM. <strong>Der</strong> Konzern<br />
gehört weltweit zu den Größten der IT-<br />
Branche und hat mit »Watson« einen<br />
angeb lichen Supercomputer geschaffen.<br />
Ausgestattet mit 90 Computerservern<br />
besiegte Watson 2011 Rekordchampions<br />
bei der US-TV-Quizshow »Jeopardy«.<br />
Watson hilft, Filmtrailer zusammenzuschneiden,<br />
indem die Software die besten<br />
Szenen ohne menschliches Zutun herausfiltert.<br />
IBM vermarktet Watson-Anwendungen<br />
für den Schienenverkehr genauso<br />
wie für Strafverteidiger.<br />
Außerdem will der Softwaregigant mit<br />
seiner Wunderwaffe die Medizin revolutionieren,<br />
jenen globalen Billionenmarkt,<br />
auf dem Hoffnung und Enttäuschung so<br />
nah beieinanderliegen. Das Versprechen<br />
ist groß. Es geht nicht um die Behandlung<br />
von Schnupfen und anderen Wehwehchen,<br />
sondern um den Albtraum jedes Menschen:<br />
Krebs oder mysteriöse Symptome,<br />
deren Ursache niemand erklären kann.<br />
<strong>Der</strong> Ansatz von Watson klingt logisch:<br />
Weil sich das medizinische Wissen aktuell<br />
alle drei Jahre verdoppelt, kann kein Arzt<br />
die Mengen an Literatur bewältigen. Zudem<br />
liefert jeder Patient extrem viele<br />
individuelle Gesundheitsdaten. Watson<br />
durchsucht diese Daten und Erkenntnisse<br />
auf die Relevanz für den Einzelfall, wie es<br />
kein Arzt könnte.<br />
Funktionsweise<br />
von Watson<br />
Wie das IBM-<br />
System in der<br />
Medizin eingesetzt<br />
wird<br />
Das jedoch ist nur die Theorie.<br />
Am Universitätsklinikum Gießen und<br />
Marburg hat man das Programm erprobt.<br />
Und ist recht froh, dass das Experiment<br />
mit Watson wieder eingestellt wurde.<br />
In der Praxis nämlich entpuppte sich das<br />
System als deutlich weniger intelligent als<br />
erhofft. Zunächst fiel es bei simpelsten<br />
Symptomen durch. Tippte der Arzt ein, dass<br />
der Patient unter Brustschmerz leide, kam<br />
anfänglich kaum etwas auf der Liste der<br />
wahrscheinlichsten Diagnosen nach oben:<br />
Herzinfarkt, Angina pectoris, Aortenriss.<br />
Stattdessen hielt Watson eine seltene Infektionskrankheit<br />
für den nicht unwahrscheinlichen<br />
Auslöser der Beschwerden. Worüber<br />
sich die Marburger Ärzte wunderten, bewegt<br />
mittlerweile die Medizin. Ist IBMs<br />
angeblicher Supercomputer Watson weniger<br />
ein Spitzenprodukt künst licher Intelligenz<br />
als vielmehr ein nutzloser Bluff und<br />
das Produkt gut gemachter Marketing -<br />
arbeit des Softwarekonzerns?<br />
Stephan Holzinger, CEO der Rhön-Klinikum<br />
AG, zu der auch das Universitätsklinikum<br />
gehört, sieht die Sache mit Watson<br />
mittlerweile tatsächlich sehr nüchtern. Als<br />
er im Februar 2017 Chef des viertgrößten<br />
deutschen Klinikkonzerns geworden war,<br />
reiste er nach Marburg, um das Watson-Projekt<br />
zu begutachten. »Die Performance war<br />
inakzeptabel, das medizinische Verständnis<br />
bei IBM nicht da. <strong>No</strong>ch nicht mal die Richtlinien<br />
der Fachgesellschaften waren eingelesen.<br />
Ich dachte mir: Wenn wir da weitermachen,<br />
investieren wir in eine Las-Vegas-<br />
Show«, sagt Holzinger. Dem Konzernchef<br />
ging es nicht ums Geld. »IBM hat so getan,<br />
als ob sie die Medizin nun völlig neu erfunden<br />
hätten. In Wahrheit waren sie blank<br />
und ohne Plan. Unsere Experten mussten<br />
sie an die Hand nehmen«, sagt Holzinger.<br />
Patientendaten<br />
<strong>Der</strong> Arzt scannt alle verfügbaren<br />
Angaben ein: Arztbriefe, Untersuchungsbefunde<br />
und die Ergebnisse<br />
der bildgebenden Verfahren<br />
(Röntgen, CT, MRT u.a.).<br />
Diagnose<br />
Nach dem Abgleich der Patientendaten<br />
mit allem verfügbaren<br />
medizinischen Wissen liefert<br />
Watson eine Diagnose oder eine<br />
Behandlungsempfehlung.<br />
<strong>Der</strong> Manager beendete das Projekt, bevor<br />
auch nur ein Patient von Dr. Watson<br />
behandelt worden war. Was dann geschah,<br />
beschreibt Holzinger so: »IBM sah in uns<br />
offenbar einen wichtigen Showcase und<br />
bearbeitete die Verantwortlichen auf allen<br />
Kanälen.« IBM spricht von einer »erfolgreichen<br />
Erprobung«, die ausgelaufen sei.<br />
Tatsächlich sind die Probleme von Watson<br />
in Marburg eine grundsätzliche Sache<br />
für IBM. Kritik entzündet sich etwa an der<br />
Spracherkennung. Die ist so essenziell wie<br />
ausbaufähig: So scannte man in Marburg<br />
Patientenunterlagen, also Arztbriefe und<br />
Untersuchungsbefunde. Watson durchsuchte<br />
diese auf Signalwörter, welche auf<br />
Dia gnosen oder Resultate hindeuten.<br />
106 DER SPIEGEL Nr. <strong>32</strong> / 4. 8. <strong>2018</strong>