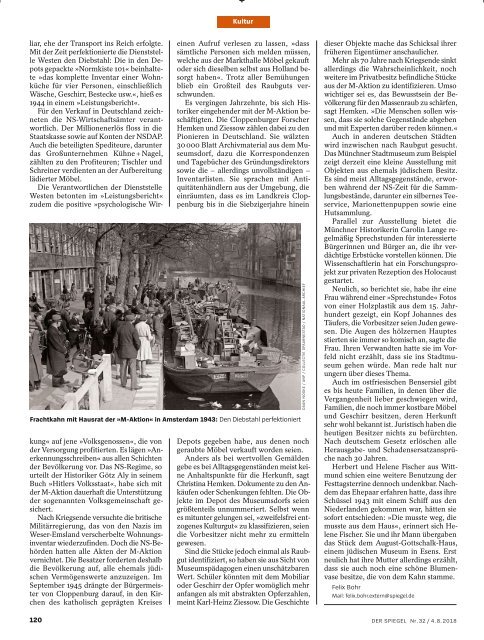Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kultur<br />
liar, ehe der Transport ins Reich erfolgte.<br />
Mit der Zeit perfektionierte die Dienststelle<br />
Westen den Diebstahl: Die in den Depots<br />
gepackte »<strong>No</strong>rmkiste 101« beinhaltete<br />
»das komplette Inventar einer Wohnküche<br />
für vier Personen, einschließlich<br />
Wäsche, Geschirr, Bestecke usw.«, hieß es<br />
1944 in einem »Leistungsbericht«.<br />
Für den Verkauf in Deutschland zeichneten<br />
die NS-Wirtschaftsämter verantwortlich.<br />
<strong>Der</strong> Millionenerlös floss in die<br />
Staatskasse sowie auf Konten der NSDAP.<br />
Auch die beteiligten Spediteure, darunter<br />
das Großunternehmen Kühne + Nagel,<br />
zählten zu den Profiteuren; Tischler und<br />
Schreiner verdienten an der Aufbereitung<br />
lädierter Möbel.<br />
Die Verantwortlichen der Dienststelle<br />
Westen betonten im »Leistungsbericht«<br />
zudem die positive »psychologische Wirkung«<br />
auf jene »Volksgenossen«, die von<br />
der Versorgung profitierten. Es lägen »Anerkennungsschreiben«<br />
aus allen Schichten<br />
der Bevölkerung vor. Das NS-Regime, so<br />
urteilt der Historiker Götz Aly in seinem<br />
Buch »Hitlers Volksstaat«, habe sich mit<br />
der M-Aktion dauerhaft die Unterstützung<br />
der sogenannten Volksgemeinschaft ge -<br />
sichert.<br />
Nach Kriegsende versuchte die britische<br />
Militärregierung, das von den Nazis im<br />
Weser-Emsland verscherbelte Wohnungsinventar<br />
wiederzufinden. Doch die NS-Behörden<br />
hatten alle Akten der M-Aktion<br />
vernichtet. Die Besatzer forderten deshalb<br />
die Bevölkerung auf, alle ehemals jüdischen<br />
Vermögenswerte anzuzeigen. Im<br />
September 1945 drängte der Bürgermeister<br />
von Cloppenburg darauf, in den Kirchen<br />
des katholisch geprägten Kreises<br />
einen Aufruf verlesen zu lassen, »dass<br />
sämtliche Personen sich melden müssen,<br />
welche aus der Markthalle Möbel gekauft<br />
oder sich dieselben selbst aus Holland besorgt<br />
haben«. Trotz aller Bemühungen<br />
blieb ein Großteil des Raubguts verschwunden.<br />
Es vergingen Jahrzehnte, bis sich Historiker<br />
eingehender mit der M-Aktion beschäftigten.<br />
Die Cloppenburger Forscher<br />
Hemken und Ziessow zählen dabei zu den<br />
Pionieren in Deutschland. Sie wälzten<br />
30 000 Blatt Archivmaterial aus dem Museumsdorf,<br />
dazu die Korrespondenzen<br />
und Tagebücher des Gründungsdirektors<br />
sowie die – allerdings unvollständigen –<br />
Inventarlisten. Sie sprachen mit Anti -<br />
quitätenhändlern aus der Umgebung, die<br />
einräumten, dass es im Landkreis Cloppenburg<br />
bis in die Siebzigerjahre hinein<br />
Frachtkahn mit Hausrat der »M-Aktion« in Amsterdam 1943: Den Diebstahl perfektioniert<br />
Depots gegeben habe, aus denen noch<br />
geraubte Möbel verkauft worden seien.<br />
Anders als bei wertvollen Gemälden<br />
gebe es bei Alltagsgegenständen meist keine<br />
Anhaltspunkte für die Herkunft, sagt<br />
Christina Hemken. Dokumente zu den Ankäufen<br />
oder Schenkungen fehlten. Die Objekte<br />
im Depot des Museumsdorfs seien<br />
größtenteils unnummeriert. Selbst wenn<br />
es mitunter gelungen sei, »zweifelsfrei entzogenes<br />
Kulturgut« zu klassifizieren, seien<br />
die Vorbesitzer nicht mehr zu ermitteln<br />
gewesen.<br />
Sind die Stücke jedoch einmal als Raubgut<br />
identifiziert, so haben sie aus Sicht von<br />
Museumspädagogen einen unschätzbaren<br />
Wert. Schüler könnten mit dem Mobiliar<br />
oder Geschirr der Opfer womöglich mehr<br />
anfangen als mit abstrakten Opferzahlen,<br />
meint Karl-Heinz Ziessow. Die Geschichte<br />
DAAN NOSKE / ANP / COLLECTIE SPAARNESTAD / NATIONAAL ARCHIEF<br />
dieser Objekte mache das Schicksal ihrer<br />
früheren Eigentümer anschaulicher.<br />
Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende sinkt<br />
allerdings die Wahrscheinlichkeit, noch<br />
weitere im Privatbesitz befindliche Stücke<br />
aus der M-Aktion zu identifizieren. Umso<br />
wichtiger sei es, das Bewusstsein der Bevölkerung<br />
für den Massenraub zu schärfen,<br />
sagt Hemken. »Die Menschen sollen wissen,<br />
dass sie solche Gegenstände abgeben<br />
und mit Experten darüber reden können.«<br />
Auch in anderen deutschen Städten<br />
wird inzwischen nach Raubgut gesucht.<br />
Das Münchner Stadtmuseum zum Beispiel<br />
zeigt derzeit eine kleine Ausstellung mit<br />
Objekten aus ehemals jüdischem Besitz.<br />
Es sind meist Alltagsgegenstände, erworben<br />
während der NS-Zeit für die Sammlungsbestände,<br />
darunter ein silbernes Teeservice,<br />
Marionettenpuppen sowie eine<br />
Hutsammlung.<br />
Parallel zur Ausstellung bietet die<br />
Münchner Historikerin Carolin Lange regelmäßig<br />
Sprechstunden für interessierte<br />
Bürgerinnen und Bürger an, die ihr verdächtige<br />
Erbstücke vorstellen können. Die<br />
Wissenschaftlerin hat ein Forschungsprojekt<br />
zur privaten Rezeption des Holocaust<br />
gestartet.<br />
Neulich, so berichtet sie, habe ihr eine<br />
Frau während einer »Sprechstunde« Fotos<br />
von einer Holzplastik aus dem 15. Jahrhundert<br />
gezeigt, ein Kopf Johannes des<br />
Täufers, die Vorbesitzer seien Juden gewesen.<br />
Die Augen des hölzernen Hauptes<br />
stierten sie immer so komisch an, sagte die<br />
Frau. Ihren Verwandten hatte sie im Vorfeld<br />
nicht erzählt, dass sie ins Stadtmuseum<br />
gehen würde. Man rede halt nur<br />
ungern über dieses Thema.<br />
Auch im ostfriesischen Bensersiel gibt<br />
es bis heute Familien, in denen über die<br />
Vergangenheit lieber geschwiegen wird,<br />
Familien, die noch immer kostbare Möbel<br />
und Geschirr besitzen, deren Herkunft<br />
sehr wohl bekannt ist. Juristisch haben die<br />
heutigen Besitzer nichts zu befürchten.<br />
Nach deutschem Gesetz erlöschen alle<br />
Herausgabe- und Schadensersatzansprüche<br />
nach 30 Jahren.<br />
Herbert und Helene Fischer aus Wittmund<br />
schien eine weitere Benutzung der<br />
Festtagsterrine dennoch undenkbar. Nachdem<br />
das Ehepaar erfahren hatte, dass ihre<br />
Schüssel 1943 mit einem Schiff aus den<br />
Niederlanden gekommen war, hätten sie<br />
sofort entschieden: »Die musste weg, die<br />
musste aus dem Haus«, erinnert sich Helene<br />
Fischer. Sie und ihr Mann übergaben<br />
das Stück dem <strong>August</strong>-Gottschalk-Haus,<br />
einem jüdischen Museum in Esens. Erst<br />
neulich hat ihre Mutter allerdings erzählt,<br />
dass sie auch noch eine schöne Blumen -<br />
vase besitze, die von dem Kahn stamme.<br />
Felix Bohr<br />
Mail: felix.bohr.extern@spiegel.de<br />
120 DER SPIEGEL Nr. <strong>32</strong> / 4. 8. <strong>2018</strong>