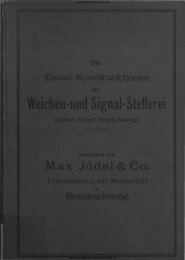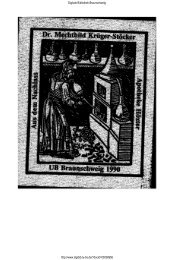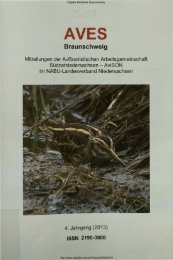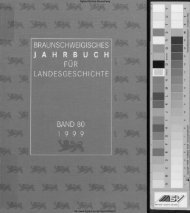10 - Digitale Bibliothek Braunschweig
10 - Digitale Bibliothek Braunschweig
10 - Digitale Bibliothek Braunschweig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Digitale</strong> <strong>Bibliothek</strong> <strong>Braunschweig</strong><br />
wurden und schließlich 1834 abbrannten. Von der Kirche haben wir eine flüchtige<br />
Skizze, die mit der Abbildung im Plan von 15'80 übereinstimmt.<br />
Die Einbrüche des Herzogs und der Stadt wurden im 18. Jahrhundert wettgemacht.<br />
Als in der Zeit des Absolutismus Töchter und Enkelinnen <strong>Braunschweig</strong>er<br />
Herzöge Äbtissinnen wurden, gelang es ihnen dank ihrer guten<br />
Beziehungen zum Hofe, viele der verlorengegangenen Gebäude wieder zu erwerben<br />
und den Domänenhof abzurunden. Jetzt entstand die Domäne.<br />
IX. Die heutige Stadt<br />
Am 27. März 1580 reichte der Amtmann Johann ScharH von Gandersheim<br />
dem Herzog einen "Abryss und Vertzaychnuss des Amptes Gandersheim" ein,<br />
dem eine Karte beigefügt war 127). Abbildung 3 zeigt uns daraus die Stadt<br />
Gandersheim in einem Ausschnitt. Die Zeichnung ist erstaunlich genau. Da sie<br />
vor dem großen Brand vom 22. 11. 1580 entstand, sehen wir das mittelalterliche<br />
Stadtbild.<br />
Der Mauerring mit den vier Stadttoren ist noch vollständig erhalten, von<br />
den Wehrtürmen ist der Hohe Turm an der rechten Ecke der Stadtmauer und<br />
der Königsturm links von der Georgsmühle eingezeichnet. Die Burg hat ihren<br />
eigenen Ausgang über die Gande.<br />
Moritzkirche und Rathaus sind noch getrennte Gebäude, die Kirche des<br />
Barfüßerklosters ist noch erhalten, ebenso das Marienkloster. Der Domänenhof<br />
ist mit Gebäuden gegen die Burgstraße abgegrenzt.<br />
Den großen Brand von 15'80, dem Südteil und Westteil der Stadt zum Opfer<br />
fielen, benutzte der Rat, die dichtbebaute Innenstadt aufzulockern.<br />
Die Kellergasse entstand 128). Die Stiftskurie des Kanonikers Georg Jakobi<br />
reichte bis an die Marktkirche. 1584 erwarb die Stadt einen Teil, um "ihren<br />
Brandschaden soviel als möglich künftiger Zeit zu verhindern" 129).<br />
Die Reutergasse 180) verband neu den Wilhelmsplatz mit der Moritzstraße.<br />
Hier grenzte die Wilhelmsburg unmittelbar an den Hof der Familie von Stöckheim.<br />
Von diesem wurde ein Teil abgetrennt. "Diese Stelle ist vom Capitel dem<br />
Rate zur Erweiterung der Gassen cediret" 181).<br />
Schließlich wurden die verbliebenen Bauteile der Marktkirche und des Rathauses<br />
zu einem Bau vereinigt; der heutige sehr eigenwillige Rathausbau entstand,<br />
durch die große Freitreppe und die Balustrade gefällig, sonst nur in<br />
Einzelteilen künstlerisch befriedigend.<br />
127) Nds. StAWb. L Alt Abt. 26 Nr. 1169.<br />
128) Nach dem Ratskeller genannt.<br />
129) Nds. StA Wb. L Alt Abt. 11 Gand. Fb. 1, VIII Nr. 23.<br />
130) Nach dem um 1768 hier wohnenden Bäckenneister Friedrich Reuter genannt.<br />
131) Wie Anm. 3, BI. 72.<br />
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00042500<br />
99