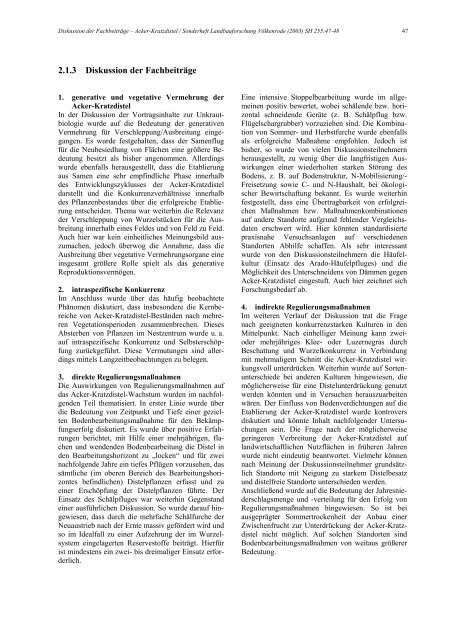Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diskussion der Fachbeiträge – Acker-Kratzdistel / <strong>Sonderheft</strong> Landbauforschung Völkenrode (2003) SH <strong>255</strong>:47-48 47<br />
2.1.3 Diskussion der Fachbeiträge<br />
1. generative und vegetative Vermehrung der<br />
Acker-Kratzdistel<br />
In der Diskussion der Vortragsinhalte zur Unkrautbiologie<br />
wurde auf die Bedeutung der generativen<br />
Vermehrung für Verschleppung/Ausbreitung eingegangen.<br />
Es wurde festgehalten, dass der Samenflug<br />
für die Neubesiedlung <strong>von</strong> Flächen eine größere Bedeutung<br />
besitzt als bisher angenommen. Allerdings<br />
wurde ebenfalls herausgestellt, dass die Etablierung<br />
aus Samen eine sehr empfindliche Phase innerhalb<br />
des Entwicklungszyklusses der Acker-Kratzdistel<br />
darstellt und die Konkurrenzverhältnisse innerhalb<br />
des Pflanzenbestandes über die erfolgreiche Etablierung<br />
entscheiden. Thema war weiterhin die Relevanz<br />
der Verschleppung <strong>von</strong> Wurzelstücken für die Ausbreitung<br />
innerhalb eines Feldes und <strong>von</strong> Feld zu Feld.<br />
Auch hier war kein einheitliches Meinungsbild auszumachen,<br />
jedoch überwog die Annahme, dass die<br />
Ausbreitung über vegetative Vermehrungsorgane eine<br />
insgesamt größere Rolle spielt als das generative<br />
Reproduktionsvermögen.<br />
2. intraspezifische Konkurrenz<br />
Im Anschluss wurde über das häufig beobachtete<br />
Phänomen diskutiert, dass insbesondere die Kernbereiche<br />
<strong>von</strong> Acker-Kratzdistel-Beständen nach mehreren<br />
Vegetationsperioden zusammenbrechen. Dieses<br />
Absterben <strong>von</strong> Pflanzen im Nestzentrum wurde u. a.<br />
auf intraspezifische Konkurrenz und Selbsterschöpfung<br />
zurückgeführt. Diese Vermutungen sind allerdings<br />
mittels Langzeitbeobachtungen zu belegen.<br />
3. direkte Regulierungsmaßnahmen<br />
Die Auswirkungen <strong>von</strong> Regulierungsmaßnahmen auf<br />
das Acker-Kratzdistel-Wachstum wurden im nachfolgenden<br />
Teil thematisiert. In erster Linie wurde über<br />
die Bedeutung <strong>von</strong> Zeitpunkt und Tiefe einer gezielten<br />
Bodenbearbeitungsmaßnahme für den Bekämpfungserfolg<br />
diskutiert. Es wurde über positive Erfahrungen<br />
berichtet, mit Hilfe einer mehrjährigen, flachen<br />
und wendenden Bodenbearbeitung die Distel in<br />
den Bearbeitungshorizont zu „locken“ und für zwei<br />
nachfolgende Jahre ein tiefes Pflügen vorzusehen, das<br />
sämtliche (im oberen Bereich des Bearbeitungshorizontes<br />
befindlichen) Distelpflanzen erfasst und zu<br />
einer Erschöpfung der Distelpflanzen führte. Der<br />
Einsatz des Schälpfluges war weiterhin Gegenstand<br />
einer ausführlichen Diskussion. So wurde darauf hingewiesen,<br />
dass durch die mehrfache Schälfurche der<br />
Neuaustrieb nach der Ernte massiv gefördert wird und<br />
so im Idealfall zu einer Aufzehrung der im Wurzelsystem<br />
eingelagerten Reservestoffe beiträgt. Hierfür<br />
ist mindestens ein zwei- bis dreimaliger Einsatz erforderlich.<br />
Eine intensive Stoppelbearbeitung wurde im allgemeinen<br />
positiv bewertet, wobei schälende bzw. horizontal<br />
schneidende Geräte (z. B. Schälpflug bzw.<br />
Flügelschargrubber) vorzuziehen sind. Die Kombination<br />
<strong>von</strong> Sommer- und Herbstfurche wurde ebenfalls<br />
als erfolgreiche Maßnahme empfohlen. Jedoch ist<br />
bisher, so wurde <strong>von</strong> vielen Diskussionsteilnehmern<br />
herausgestellt, zu wenig über die langfristigen Auswirkungen<br />
einer wiederholten starken Störung des<br />
Bodens, z. B. auf Bodenstruktur, N-Mobilisierung/-<br />
Freisetzung sowie C- und N-Haushalt, bei ökologischer<br />
Bewirtschaftung bekannt. Es wurde weiterhin<br />
festgestellt, dass eine Übertragbarkeit <strong>von</strong> erfolgreichen<br />
Maßnahmen bzw. Maßnahmenkombinationen<br />
auf andere Standorte aufgrund fehlender Vergleichsdaten<br />
erschwert wird. Hier könnten standardisierte<br />
praxisnahe Versuchsanlagen auf verschiedenen<br />
Standorten Abhilfe schaffen. Als sehr interessant<br />
wurde <strong>von</strong> den Diskussionsteilnehmern die Häufelkultur<br />
(Einsatz des Arado-Häufelpfluges) und die<br />
Möglichkeit des Unterschneidens <strong>von</strong> Dämmen gegen<br />
Acker-Kratzdistel eingestuft. Auch hier zeichnet sich<br />
Forschungsbedarf ab.<br />
4. indirekte Regulierungsmaßnahmen<br />
Im weiteren Verlauf der Diskussion trat die Frage<br />
nach geeigneten konkurrenzstarken Kulturen in den<br />
Mittelpunkt. Nach einhelliger Meinung kann zwei-<br />
oder mehrjähriges Klee- oder Luzernegras durch<br />
Beschattung und Wurzelkonkurrenz in Verbindung<br />
mit mehrmaligem Schnitt die Acker-Kratzdistel wirkungsvoll<br />
unterdrücken. Weiterhin wurde auf Sortenunterschiede<br />
bei anderen Kulturen hingewiesen, die<br />
möglicherweise für eine Distelunterdrückung genutzt<br />
werden könnten und in Versuchen herauszuarbeiten<br />
wären. Der Einfluss <strong>von</strong> Bodenverdichtungen auf die<br />
Etablierung der Acker-Kratzdistel wurde kontrovers<br />
diskutiert und könnte Inhalt nachfolgender Untersuchungen<br />
sein. Die Frage nach der möglicherweise<br />
geringeren Verbreitung der Acker-Kratzdistel auf<br />
landwirtschaftlichen Nutzflächen in früheren Jahren<br />
wurde nicht eindeutig beantwortet. Vielmehr können<br />
nach Meinung der Diskussionsteilnehmer grundsätzlich<br />
Standorte mit Neigung zu starkem Distelbesatz<br />
und distelfreie Standorte unterschieden werden.<br />
Anschließend wurde auf die Bedeutung der Jahresniederschlagsmenge<br />
und -verteilung für den Erfolg <strong>von</strong><br />
Regulierungsmaßnahmen hingewiesen. So ist bei<br />
ausgeprägter Sommertrockenheit der Anbau einer<br />
Zwischenfrucht zur Unterdrückung der Acker-Kratzdistel<br />
nicht möglich. Auf solchen Standorten sind<br />
Bodenbearbeitungsmaßnahmen <strong>von</strong> weitaus größerer<br />
Bedeutung.