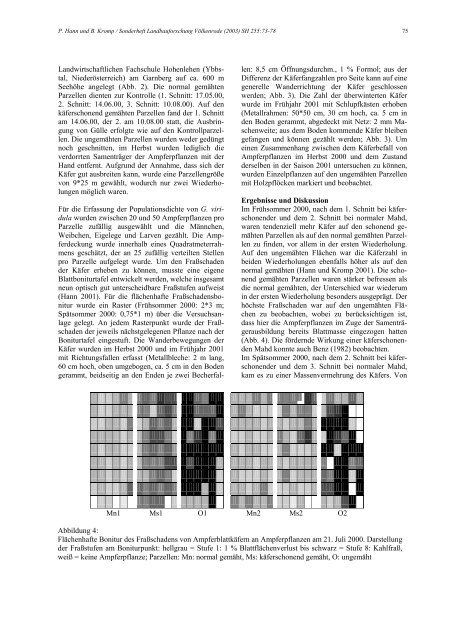Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
P. Hann und B. Kromp / <strong>Sonderheft</strong> Landbauforschung Völkenrode (2003) SH <strong>255</strong>:73-78 75<br />
Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen (Ybbstal,<br />
Niederösterreich) am Garnberg auf ca. 600 m<br />
Seehöhe angelegt (Abb. 2). Die normal gemähten<br />
Parzellen dienten zur Kontrolle (1. Schnitt: 17.05.00,<br />
2. Schnitt: 14.06.00, 3. Schnitt: 10.08.00). Auf den<br />
käferschonend gemähten Parzellen fand der 1. Schnitt<br />
am 14.06.00, der 2. am 10.08.00 statt, die Ausbringung<br />
<strong>von</strong> Gülle erfolgte wie auf den Kontrollparzellen.<br />
Die ungemähten Parzellen wurden weder gedüngt<br />
noch geschnitten, im Herbst wurden lediglich die<br />
verdorrten Samenträger der Ampferpflanzen mit der<br />
Hand entfernt. Aufgrund der Annahme, dass sich der<br />
Käfer gut ausbreiten kann, wurde eine Parzellengröße<br />
<strong>von</strong> 9*25 m gewählt, wodurch nur zwei Wiederholungen<br />
möglich waren.<br />
Für die Erfassung der Populationsdichte <strong>von</strong> G. viridula<br />
wurden zwischen 20 und 50 Ampferpflanzen pro<br />
Parzelle zufällig ausgewählt und die Männchen,<br />
Weibchen, Eigelege und Larven gezählt. Die Ampferdeckung<br />
wurde innerhalb eines Quadratmeterrahmens<br />
geschätzt, der an 25 zufällig verteilten Stellen<br />
pro Parzelle aufgelegt wurde. Um den Fraßschaden<br />
der Käfer erheben zu können, musste eine eigene<br />
Blattboniturtafel entwickelt werden, welche insgesamt<br />
neun optisch gut unterscheidbare Fraßstufen aufweist<br />
(Hann 2001). Für die flächenhafte Fraßschadensbonitur<br />
wurde ein Raster (Frühsommer 2000: 2*3 m;<br />
Spätsommer 2000: 0,75*1 m) über die Versuchsanlage<br />
gelegt. An jedem Rasterpunkt wurde der Fraßschaden<br />
der jeweils nächstgelegenen Pflanze nach der<br />
Boniturtafel eingestuft. Die Wanderbewegungen der<br />
Käfer wurden im Herbst 2000 und im Frühjahr 2001<br />
mit Richtungsfallen erfasst (Metallbleche: 2 m lang,<br />
60 cm hoch, oben umgebogen, ca. 5 cm in den Boden<br />
gerammt, beidseitig an den Enden je zwei Becherfal-<br />
len: 8,5 cm Öffnungsdurchm., 1 % Formol; aus der<br />
Differenz der Käferfangzahlen pro Seite kann auf eine<br />
generelle Wanderrichtung der Käfer geschlossen<br />
werden; Abb. 3). Die Zahl der überwinterten Käfer<br />
wurde im Frühjahr 2001 mit Schlupfkästen erhoben<br />
(Metallrahmen: 50*50 cm, 30 cm hoch, ca. 5 cm in<br />
den Boden gerammt, abgedeckt mit Netz: 2 mm Maschenweite;<br />
aus dem Boden kommende Käfer bleiben<br />
gefangen und können gezählt werden; Abb. 3). Um<br />
einen Zusammenhang zwischen dem Käferbefall <strong>von</strong><br />
Ampferpflanzen im Herbst 2000 und dem Zustand<br />
derselben in der Saison 2001 untersuchen zu können,<br />
wurden Einzelpflanzen auf den ungemähten Parzellen<br />
mit Holzpflöcken markiert und beobachtet.<br />
Ergebnisse und Diskussion<br />
Im Frühsommer 2000, nach dem 1. Schnitt bei käferschonender<br />
und dem 2. Schnitt bei normaler Mahd,<br />
waren tendenziell mehr Käfer auf den schonend gemähten<br />
Parzellen als auf den normal gemähten Parzellen<br />
zu finden, vor allem in der ersten Wiederholung.<br />
Auf den ungemähten Flächen war die Käferzahl in<br />
beiden Wiederholungen ebenfalls höher als auf den<br />
normal gemähten (Hann und Kromp 2001). Die schonend<br />
gemähten Parzellen waren stärker befressen als<br />
die normal gemähten, der Unterschied war wiederum<br />
in der ersten Wiederholung besonders ausgeprägt. Der<br />
höchste Fraßschaden war auf den ungemähten Flächen<br />
zu beobachten, wobei zu berücksichtigen ist,<br />
dass hier die Ampferpflanzen im Zuge der Samenträgerausbildung<br />
bereits Blattmasse eingezogen hatten<br />
(Abb. 4). Die fördernde Wirkung einer käferschonenden<br />
Mahd konnte auch Benz (1982) beobachten.<br />
Im Spätsommer 2000, nach dem 2. Schnitt bei käferschonender<br />
und dem 3. Schnitt bei normaler Mahd,<br />
kam es zu einer Massenvermehrung des Käfers. Von<br />
Mn1 Ms1 O1 Mn2 Ms2 O2<br />
Abbildung 4:<br />
Flächenhafte Bonitur des Fraßschadens <strong>von</strong> Ampferblattkäfern an Ampferpflanzen am 21. Juli 2000. Darstellung<br />
der Fraßstufen am Boniturpunkt: hellgrau = Stufe 1: 1 % Blattflächenverlust bis schwarz = Stufe 8: Kahlfraß,<br />
weiß = keine Ampferpflanze; Parzellen: Mn: normal gemäht, Ms: käferschonend gemäht, O: ungemäht