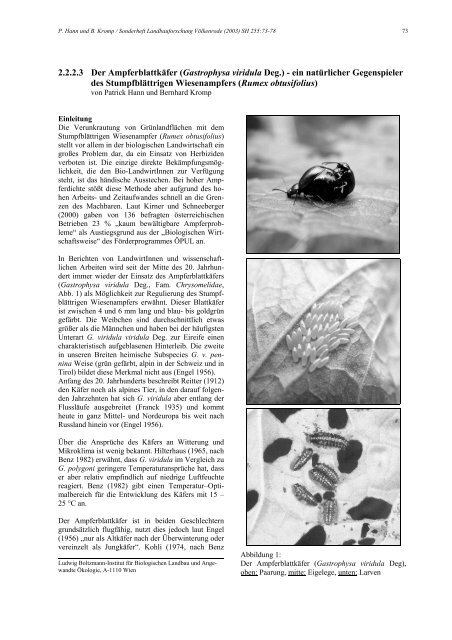Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
P. Hann und B. Kromp / <strong>Sonderheft</strong> Landbauforschung Völkenrode (2003) SH <strong>255</strong>:73-78 73<br />
2.2.2.3 Der Ampferblattkäfer (Gastrophysa viridula Deg.) - ein natürlicher Gegenspieler<br />
des Stumpfblättrigen Wiesenampfers (Rumex obtusifolius)<br />
<strong>von</strong> Patrick Hann und Bernhard Kromp<br />
Einleitung<br />
Die Verunkrautung <strong>von</strong> Grünlandflächen mit dem<br />
Stumpfblättrigen Wiesenampfer (Rumex obtusifolius)<br />
stellt vor allem in der biologischen Landwirtschaft ein<br />
großes Problem dar, da ein Einsatz <strong>von</strong> Herbiziden<br />
verboten ist. Die einzige direkte Bekämpfungsmöglichkeit,<br />
die den Bio-LandwirtInnen zur Verfügung<br />
steht, ist das händische Ausstechen. Bei hoher Ampferdichte<br />
stößt diese Methode aber aufgrund des hohen<br />
Arbeits- und Zeitaufwandes schnell an die Grenzen<br />
des Machbaren. Laut Kirner und Schneeberger<br />
(2000) gaben <strong>von</strong> 136 befragten österreichischen<br />
Betrieben 23 % „kaum bewältigbare Ampferprobleme“<br />
als Austiegsgrund aus der „Biologischen Wirtschaftsweise“<br />
des Förderprogrammes ÖPUL an.<br />
In Berichten <strong>von</strong> LandwirtInnen und wissenschaftlichen<br />
Arbeiten wird seit der Mitte des 20. Jahrhundert<br />
immer wieder der Einsatz des Ampferblattkäfers<br />
(Gastrophysa viridula Deg., Fam. Chrysomelidae,<br />
Abb. 1) als Möglichkeit zur Regulierung des Stumpfblättrigen<br />
Wiesenampfers erwähnt. Dieser Blattkäfer<br />
ist zwischen 4 und 6 mm lang und blau- bis goldgrün<br />
gefärbt. Die Weibchen sind durchschnittlich etwas<br />
größer als die Männchen und haben bei der häufigsten<br />
Unterart G. viridula viridula Deg. zur Eireife einen<br />
charakteristisch aufgeblasenen Hinterleib. Die zweite<br />
in unseren Breiten heimische Subspecies G. v. pennina<br />
Weise (grün gefärbt, alpin in der Schweiz und in<br />
Tirol) bildet diese Merkmal nicht aus (Engel 1956).<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts beschreibt Reitter (1912)<br />
den Käfer noch als alpines Tier, in den darauf folgenden<br />
Jahrzehnten hat sich G. viridula aber entlang der<br />
Flussläufe ausgebreitet (Franck 1935) und kommt<br />
heute in ganz Mittel- und Nordeuropa bis weit nach<br />
Russland hinein vor (Engel 1956).<br />
Über die Ansprüche des Käfers an Witterung und<br />
Mikroklima ist wenig bekannt. Hilterhaus (1965, nach<br />
Benz 1982) erwähnt, dass G. viridula im Vergleich zu<br />
G. polygoni geringere Temperaturansprüche hat, dass<br />
er aber relativ empfindlich auf niedrige Luftfeuchte<br />
reagiert. Benz (1982) gibt einen Temperatur–Optimalbereich<br />
für die Entwicklung des Käfers mit 15 –<br />
25 °C an.<br />
Der Ampferblattkäfer ist in beiden Geschlechtern<br />
grundsätzlich flugfähig, nutzt dies jedoch laut Engel<br />
(1956) „nur als Altkäfer nach der Überwinterung oder<br />
vereinzelt als Jungkäfer“. Kohli (1974, nach Benz<br />
Ludwig Boltzmann-<strong>Institut</strong> für Biologischen Landbau und Angewandte<br />
Ökologie, A-1110 Wien<br />
Abbildung 1:<br />
Der Ampferblattkäfer (Gastrophysa viridula Deg),<br />
oben: Paarung, mitte: Eigelege, unten: Larven