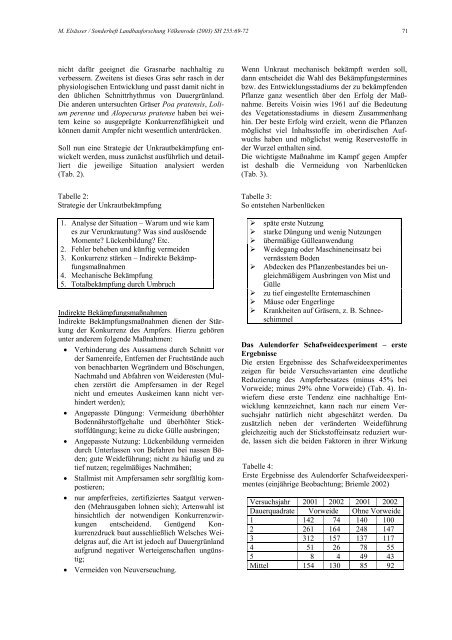Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
M. Elsässer / <strong>Sonderheft</strong> Landbauforschung Völkenrode (2003) SH <strong>255</strong>:69-72 71<br />
nicht dafür geeignet die Grasnarbe nachhaltig zu<br />
verbessern. Zweitens ist dieses Gras sehr rasch in der<br />
physiologischen Entwicklung und passt damit nicht in<br />
den üblichen Schnittrhythmus <strong>von</strong> Dauergrünland.<br />
Die anderen untersuchten Gräser Poa pratensis, Lolium<br />
perenne und Alopecurus pratense haben bei weitem<br />
keine so ausgeprägte Konkurrenzfähigkeit und<br />
können damit Ampfer nicht wesentlich unterdrücken.<br />
Soll nun eine Strategie der Unkrautbekämpfung entwickelt<br />
werden, muss zunächst ausführlich und detailliert<br />
die jeweilige Situation analysiert werden<br />
(Tab. 2).<br />
Tabelle 2:<br />
Strategie der Unkrautbekämpfung<br />
1. Analyse der Situation – Warum und wie kam<br />
es zur Verunkrautung? Was sind auslösende<br />
Momente? Lückenbildung? Etc.<br />
2. Fehler beheben und künftig vermeiden<br />
3. Konkurrenz stärken – Indirekte Bekämpfungsmaßnahmen<br />
4. Mechanische Bekämpfung<br />
5. Totalbekämpfung durch Umbruch<br />
Indirekte Bekämpfungsmaßnahmen<br />
Indirekte Bekämpfungsmaßnahmen dienen der Stärkung<br />
der Konkurrenz des Ampfers. Hierzu gehören<br />
unter anderem folgende Maßnahmen:<br />
• Verhinderung des Aussamens durch Schnitt vor<br />
der Samenreife, Entfernen der Fruchtstände auch<br />
<strong>von</strong> benachbarten Wegrändern und Böschungen,<br />
Nachmahd und Abfahren <strong>von</strong> Weideresten (Mulchen<br />
zerstört die Ampfersamen in der Regel<br />
nicht und erneutes Auskeimen kann nicht verhindert<br />
werden);<br />
• Angepasste Düngung: Vermeidung überhöhter<br />
Bodennährstoffgehalte und überhöhter Stickstoffdüngung;<br />
keine zu dicke Gülle ausbringen;<br />
• Angepasste Nutzung: Lückenbildung vermeiden<br />
durch Unterlassen <strong>von</strong> Befahren bei nassen Böden;<br />
gute Weideführung; nicht zu häufig und zu<br />
tief nutzen; regelmäßiges Nachmähen;<br />
• Stallmist mit Ampfersamen sehr sorgfältig kompostieren;<br />
• nur ampferfreies, zertifiziertes Saatgut verwenden<br />
(Mehrausgaben lohnen sich); Artenwahl ist<br />
hinsichtlich der notwendigen Konkurrenzwirkungen<br />
entscheidend. Genügend Konkurrenzdruck<br />
baut ausschließlich Welsches Weidelgras<br />
auf, die Art ist jedoch auf Dauergrünland<br />
aufgrund negativer Werteigenschaften ungünstig;<br />
• Vermeiden <strong>von</strong> Neuverseuchung.<br />
Wenn Unkraut mechanisch bekämpft werden soll,<br />
dann entscheidet die Wahl des Bekämpfungstermines<br />
bzw. des Entwicklungsstadiums der zu bekämpfenden<br />
Pflanze ganz wesentlich über den Erfolg der Maßnahme.<br />
Bereits Voisin wies 1961 auf die Bedeutung<br />
des Vegetationsstadiums in diesem Zusammenhang<br />
hin. Der beste Erfolg wird erzielt, wenn die Pflanzen<br />
möglichst viel Inhaltsstoffe im oberirdischen Aufwuchs<br />
haben und möglichst wenig Reservestoffe in<br />
der Wurzel enthalten sind.<br />
Die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen Ampfer<br />
ist deshalb die Vermeidung <strong>von</strong> Narbenlücken<br />
(Tab. 3).<br />
Tabelle 3:<br />
So entstehen Narbenlücken<br />
späte erste Nutzung<br />
starke Düngung und wenig Nutzungen<br />
übermäßige Gülleanwendung<br />
Weidegang oder Maschineneinsatz bei<br />
vernässtem Boden<br />
Abdecken des Pflanzenbestandes bei ungleichmäßigem<br />
Ausbringen <strong>von</strong> Mist und<br />
Gülle<br />
zu tief eingestellte Erntemaschinen<br />
Mäuse oder Engerlinge<br />
Krankheiten auf Gräsern, z. B. Schneeschimmel<br />
Das Aulendorfer Schafweideexperiment – erste<br />
Ergebnisse<br />
Die ersten Ergebnisse des Schafweideexperimentes<br />
zeigen für beide Versuchsvarianten eine deutliche<br />
Reduzierung des Ampferbesatzes (minus 45% bei<br />
Vorweide; minus 29% ohne Vorweide) (Tab. 4). Inwiefern<br />
diese erste Tendenz eine nachhaltige Entwicklung<br />
kennzeichnet, kann nach nur einem Versuchsjahr<br />
natürlich nicht abgeschätzt werden. Da<br />
zusätzlich neben der veränderten Weideführung<br />
gleichzeitig auch der Stickstoffeinsatz reduziert wurde,<br />
lassen sich die beiden Faktoren in ihrer Wirkung<br />
Tabelle 4:<br />
Erste Ergebnisse des Aulendorfer Schafweideexperimentes<br />
(einjährige Beobachtung; Briemle 2002)<br />
Versuchsjahr 2001 2002 2001 2002<br />
Dauerquadrate Vorweide Ohne Vorweide<br />
1 142 74 140 100<br />
2 261 164 248 147<br />
3 312 157 137 117<br />
4 51 26 78 55<br />
5 8 4 49 43<br />
Mittel 154 130 85 92