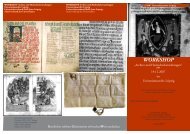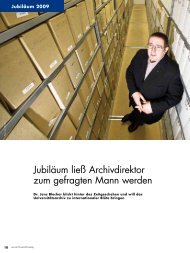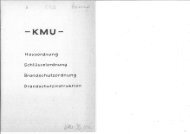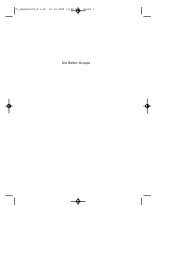Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Laus „Zittern und Zagen“ bezog sich auf seine Vorgänger, die im 19. und in der<br />
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Garanten für die Bedeutung der <strong>Leipzig</strong>er<br />
Theologischen Fakultät für die deutsche Wissenschaft gewesen waren wie Albert<br />
Hauck (1845-1918), Heinrich Böhmer (1869-1927) oder sein unmittelbarer Vorgänger<br />
Heinrich Bornkamm (1901-1977).<br />
Mit <strong>Leipzig</strong> war das Leben Christian Karl Bernhard Franz Laus sehr eng verbunden.<br />
In <strong>Leipzig</strong>-Connewitz am 18. Februar 1907 als erstes Kind des Landrichters<br />
und späteren Landgerichtsrates Dr. jur. Leopold Lau († 1916) und seiner<br />
zweiten Frau Emma Elisabeth, geb. Petzold († 1945) geboren, sollte sich sein<br />
Leben auch hier vollenden. Er starb am 6. Juni 1973 in der <strong>Universität</strong>sklinik.<br />
Nach drei Jahren Volksschule besuchte er von 1916 bis 1925 das <strong>Leipzig</strong>er<br />
Königin-Carola-Gymnasium. Zunächst schrieb er sich in <strong>Leipzig</strong> für Germanistik,<br />
Philosophie und Geschichte ein, wobei er sich vor allem für die beiden<br />
letzteren Fächer interessierte. Besonders Hans Driesch (1867-1941) und sein<br />
Lehrer in Geschichte, Siegmund Hellmann (1872-1942), prägten ihn und seinen<br />
späteren Weg. Hellmann stand ihm nahe, als 1923 sein Großvater Karl Gustav<br />
Petzold (1841-1923) starb, mit dem er seit dem Tod des Vaters 1916 eine besonders<br />
enge Beziehung hatte. Petzold – aus einfachen Verhältnissen in Stötteritz bei<br />
<strong>Leipzig</strong> stammend – war sächsischer Pfarrer gewesen, ehe er seinen Ruhestand<br />
in <strong>Leipzig</strong> verbrachte. Ihm und Hellmann verdankte Lau seinen Entschluss,<br />
Theologie zu studieren. Nach einem kurzen Studienaufenthalt in Wien begann er<br />
das Studium im Frühjahr 1927 in <strong>Leipzig</strong> und legte 1930 das Erste Theologische<br />
Examen ab. Auf eine Zeit am Predigerkolleg St. Pauli folgte 1931 bis 1932 eine<br />
Assistentenstelle bei dem Systematiker Horst Stephan (1873-1954). Aus dieser<br />
Beschäftigung ging seine 1933 eingereichte Licentiatenarbeit „Äußerlich<br />
Ordnung und weltliche Ding in Luthers Theologie“ hervor. Hier verhandelte Lau<br />
bereits das Thema, das ihn sein ganzes Leben nicht mehr loslassen und immer<br />
wieder ungeahnte Aktualität entwickeln sollte: die Frage nach der Göttlichkeit<br />
weltlicher Ordnungen, nach den Regierweisen Gottes in dieser Welt.<br />
Aus Sorge um eine sichere Existenz seiner Familie übernahm er im Oktober<br />
1932 – zunächst als Pfarrvikar – die Pfarrstelle in Regis-Breitingen südlich von<br />
<strong>Leipzig</strong>. Versuche, ihn an der <strong>Universität</strong> zu halten, schlugen fehl. Ziemlich rasch<br />
positionierte er sich in dem sich zuspitzenden Kirchenkampf zwischen Deutschen<br />
Christen (DC) und Bekennender Kirche (BK). Die Glaubensbewegung<br />
„Deutsche Christen“ hatte sich eng an das Parteiprogramm der NSDAP angelehnt<br />
und vor allem aus der dortigen Erwähnung eines „positiven Christentums“<br />
die Hoffnung geschöpft, mit dem Aufschwung der nationalsozialistischen Bewegung<br />
einen kirchlichen Aufschwung verbinden zu können. In der BK allerdings<br />
10