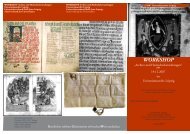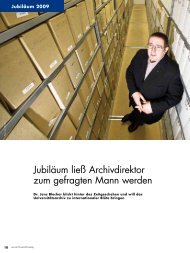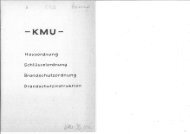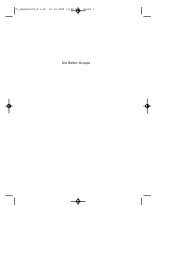Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die Rechte, daneben die griechische Sprache. In den Kämpfen des Kaisers gegen<br />
die Venezianer musste er wiederholt die Kriegsgräuel persönlich erfahren. Ihren<br />
poetischen Ausdruck fanden die Erlebnisse und seine Gesinnung in einem<br />
Buch Epigramme an Kaiser Maximilian („Ad Caesarem Maximilianum Epigrammatum<br />
Liber unus“). Die Verse dienten dem Ruhme des Herrschers, riefen<br />
ihn zwecks Sicherung und Erweiterung der Reichsgrenzen zu entschlossenem<br />
Handeln auf und schmähten dessen Gegner, auch den Papst. Zugleich zeigten sie<br />
Huttens Dichtkunst auf ihrem künstlerischen Höhepunkt.<br />
Nach Deutschland zurückgekehrt, warf er sich sogleich in eine Fehde, mit welcher<br />
die Sippe der Hutten einen heimtückischen Mord, den der Württemberger<br />
Herzog Ulrich an einem der Ihren verübt hatte, zu rächen suchte. Neben einigen<br />
lateinischen Invektiven gegen den Fürsten bestand Huttens Beitrag vor allem in<br />
dem literarischen Dialog „Phalarismus“: Antike Motive mit den Mitteln der literarischen<br />
Satire zielgerichtet verbindend, prangerte jener darin tyrannische Willkür<br />
auf das schneidigste an und bewies einmal mehr, wie Stoffe des griechischrömischen<br />
Altertums für Bestrebungen und Kontroversen der Gegenwart nutzbar<br />
gemacht werden konnten.<br />
Der zweite Italienaufenthalt (1515-1517) diente Hutten zur Fortführung seiner<br />
Studien. In diese Zeit fiel ein Waffengang, bei welchem der Ritter einen Gegner<br />
tödlich traf, ein Vorfall, den er wiederholt und unter verschiedenen Aspekten<br />
dargestellt hat. Durch den sogenannten Reuchlinstreit in Deutschland und seine<br />
eigene Begegnung mit Entartungserscheinungen unter der römischen Geistlichkeit<br />
verschärfte sich damals Huttens kritische Haltung gegenüber der Kurie bis<br />
zu einer entschiedenen Kampfansage gegen das Papsttum: Als in Deutschland<br />
der zum Christentum konvertierte Jude Johann Pfefferkorn im Dienste der Kölner<br />
Dominikaner die Verbrennung allen jüdischen Schrifttums mit Ausnahme der<br />
alttestamentlichen Texte forderte, verwarf der Jurist und Hebraist Johannes Reuchlin<br />
in einem Rechtsgutachten vom Jahre 1510 dieses Ansinnen als durchweg<br />
unrechtmäßig. Die Gegenseite reagierte mit heftigen Angriffen. Da erschienen<br />
1515 anonym die „Epistolae obscurorum virorum“, ein Werk hauptsächlich des<br />
Humanisten Crotus Rubeanus. Es enthielt fiktive lateinische Briefe und zielte<br />
auf eine satirische Selbstentlarvung der Kölner Theologen hin. Den ersten Brief<br />
hatte Hutten beigesteuert, die Handlung übrigens in <strong>Leipzig</strong> lokalisiert. Später<br />
schrieb er in Italien als Hauptautor neben Hermann von dem Busche einen zweiten<br />
Teil und gab ihn 1517 in Köln heraus. In Form einer mimischen Satire lasteten<br />
die „Dunkelmännerbriefe“ Reuchlins Gegnern Engstirnigkeit, Glaubensfanatismus,<br />
Dogmatismus und eine ihrem geistlichen Stande unangemessene<br />
Lebensführung an, zudem verurteilten sie die Politik der römischen Kurie. Ihre<br />
84