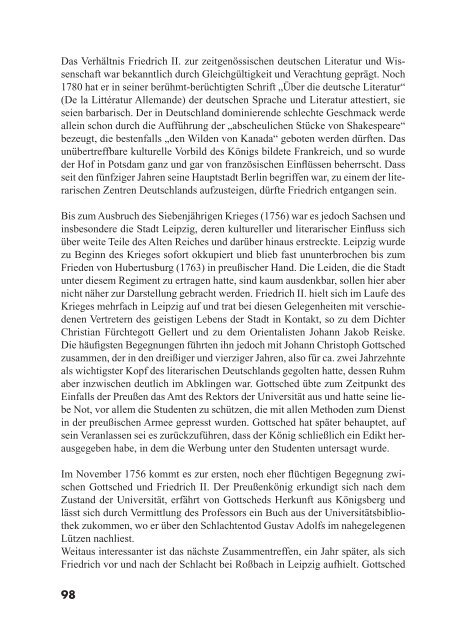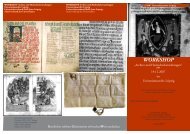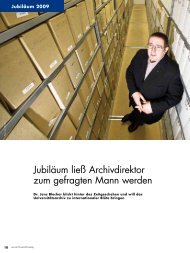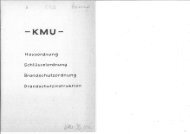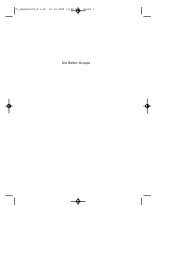Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Verhältnis Friedrich II. zur zeitgenössischen deutschen Literatur und Wissenschaft<br />
war bekanntlich durch Gleichgültigkeit und Verachtung geprägt. Noch<br />
1780 hat er in seiner berühmt-berüchtigten Schrift „Über die deutsche Literatur“<br />
(De la Littératur Allemande) der deutschen Sprache und Literatur attestiert, sie<br />
seien barbarisch. Der in Deutschland dominierende schlechte Geschmack werde<br />
allein schon durch die Aufführung der „abscheulichen Stücke von Shakespeare“<br />
bezeugt, die bestenfalls „den Wilden von Kanada“ geboten werden dürften. Das<br />
unübertreffbare kulturelle Vorbild des Königs bildete Frankreich, und so wurde<br />
der Hof in Potsdam ganz und gar von französischen Einflüssen beherrscht. Dass<br />
seit den fünfziger Jahren seine Hauptstadt Berlin begriffen war, zu einem der literarischen<br />
Zentren Deutschlands aufzusteigen, dürfte Friedrich entgangen sein.<br />
Bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges (1756) war es jedoch Sachsen und<br />
insbesondere die Stadt <strong>Leipzig</strong>, deren kultureller und literarischer Einfluss sich<br />
über weite Teile des Alten Reiches und darüber hinaus erstreckte. <strong>Leipzig</strong> wurde<br />
zu Beginn des Krieges sofort okkupiert und blieb fast ununterbrochen bis zum<br />
Frieden von Hubertusburg (1763) in preußischer Hand. Die Leiden, die die Stadt<br />
unter diesem Regiment zu ertragen hatte, sind kaum ausdenkbar, sollen hier aber<br />
nicht näher zur Darstellung gebracht werden. Friedrich II. hielt sich im Laufe des<br />
Krieges mehrfach in <strong>Leipzig</strong> auf und trat bei diesen Gelegenheiten mit verschiedenen<br />
Vertretern des geistigen Lebens der Stadt in Kontakt, so zu dem Dichter<br />
Christian Fürchtegott Gellert und zu dem Orientalisten Johann Jakob Reiske.<br />
Die häufigsten Begegnungen führten ihn jedoch mit Johann Christoph Gottsched<br />
zusammen, der in den dreißiger und vierziger Jahren, also für ca. zwei Jahrzehnte<br />
als wichtigster Kopf des literarischen Deutschlands gegolten hatte, dessen Ruhm<br />
aber inzwischen deutlich im Abklingen war. Gottsched übte zum Zeitpunkt des<br />
Einfalls der Preußen das Amt des Rektors der <strong>Universität</strong> aus und hatte seine liebe<br />
Not, vor allem die Studenten zu schützen, die mit allen Methoden zum Dienst<br />
in der preußischen Armee gepresst wurden. Gottsched hat später behauptet, auf<br />
sein Veranlassen sei es zurückzuführen, dass der König schließlich ein Edikt herausgegeben<br />
habe, in dem die Werbung unter den Studenten untersagt wurde.<br />
Im November 1756 kommt es zur ersten, noch eher flüchtigen Begegnung zwischen<br />
Gottsched und Friedrich II. Der Preußenkönig erkundigt sich nach dem<br />
Zustand der <strong>Universität</strong>, erfährt von Gottscheds Herkunft aus Königsberg und<br />
lässt sich durch Vermittlung des Professors ein Buch aus der <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
zukommen, wo er über den Schlachtentod Gustav Adolfs im nahegelegenen<br />
Lützen nachliest.<br />
Weitaus interessanter ist das nächste Zusammentreffen, ein Jahr später, als sich<br />
Friedrich vor und nach der Schlacht bei Roßbach in <strong>Leipzig</strong> aufhielt. Gottsched<br />
98