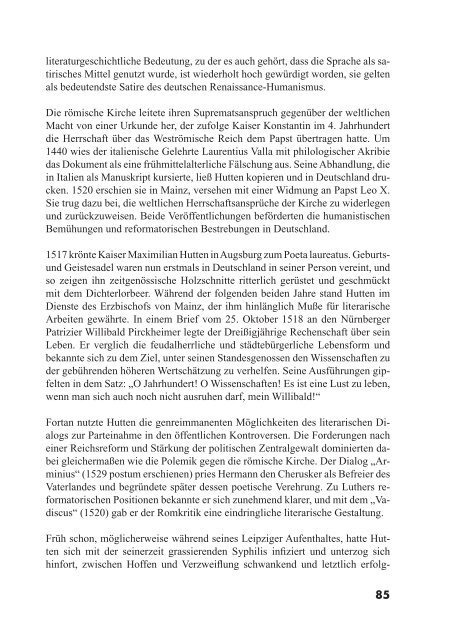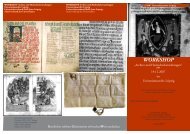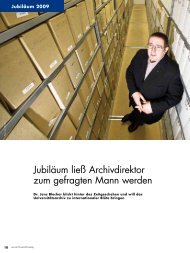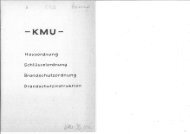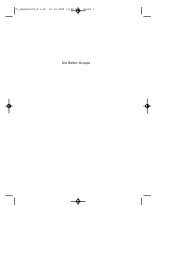Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
literaturgeschichtliche Bedeutung, zu der es auch gehört, dass die Sprache als satirisches<br />
Mittel genutzt wurde, ist wiederholt hoch gewürdigt worden, sie gelten<br />
als bedeutendste Satire des deutschen Renaissance-Humanismus.<br />
Die römische Kirche leitete ihren Suprematsanspruch gegenüber der weltlichen<br />
Macht von einer Urkunde her, der zufolge Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert<br />
die Herrschaft über das Weströmische Reich dem Papst übertragen hatte. Um<br />
1440 wies der italienische Gelehrte Laurentius Valla mit philologischer Akribie<br />
das Dokument als eine frühmittelalterliche Fälschung aus. Seine Abhandlung, die<br />
in Italien als Manuskript kursierte, ließ Hutten kopieren und in Deutschland drucken.<br />
1520 erschien sie in Mainz, versehen mit einer Widmung an Papst Leo X.<br />
Sie trug dazu bei, die weltlichen Herrschaftsansprüche der Kirche zu widerlegen<br />
und zurückzuweisen. Beide Veröffentlichungen beförderten die humanistischen<br />
Bemühungen und reformatorischen Bestrebungen in Deutschland.<br />
1517 krönte Kaiser Maximilian Hutten in Augsburg zum Poeta laureatus. Geburts-<br />
und Geistesadel waren nun erstmals in Deutschland in seiner Person vereint, und<br />
so zeigen ihn zeitgenössische Holzschnitte ritterlich gerüstet und geschmückt<br />
mit dem Dichterlorbeer. Während der folgenden beiden Jahre stand Hutten im<br />
Dienste des Erzbischofs von Mainz, der ihm hinlänglich Muße für literarische<br />
Arbeiten gewährte. In einem Brief vom 25. Oktober 1518 an den Nürnberger<br />
Patrizier Willibald Pirckheimer legte der Dreißigjährige Rechenschaft über sein<br />
Leben. Er verglich die feudalherrliche und städtebürgerliche Lebensform und<br />
bekannte sich zu dem Ziel, unter seinen Standesgenossen den Wissenschaften zu<br />
der gebührenden höheren Wertschätzung zu verhelfen. Seine Ausführungen gipfelten<br />
in dem Satz: „O Jahrhundert! O Wissenschaften! Es ist eine Lust zu leben,<br />
wenn man sich auch noch nicht ausruhen darf, mein Willibald!“<br />
Fortan nutzte Hutten die genreimmanenten Möglichkeiten des literarischen Dialogs<br />
zur Parteinahme in den öffentlichen Kontroversen. Die Forderungen nach<br />
einer Reichsreform und Stärkung der politischen Zentralgewalt dominierten dabei<br />
gleichermaßen wie die Polemik gegen die römische Kirche. Der Dialog „Arminius“<br />
(1529 postum erschienen) pries Hermann den Cherusker als Befreier des<br />
Vaterlandes und begründete später dessen poetische Verehrung. Zu Luthers reformatorischen<br />
Positionen bekannte er sich zunehmend klarer, und mit dem „Vadiscus“<br />
(1520) gab er der Romkritik eine eindringliche literarische Gestaltung.<br />
Früh schon, möglicherweise während seines <strong>Leipzig</strong>er Aufenthaltes, hatte Hutten<br />
sich mit der seinerzeit grassierenden Syphilis infiziert und unterzog sich<br />
hinfort, zwischen Hoffen und Verzweiflung schwankend und letztlich erfolg-<br />
85