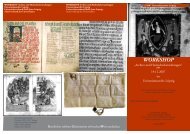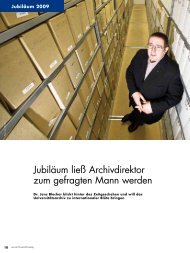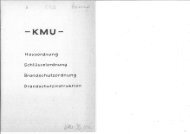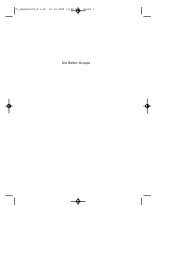Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Jubiläen 2007 - Universitätsarchiv Leipzig - Universität Leipzig
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1937 erwarb er mit der Promotion zum Thema „Der menschliche Staat als Problem<br />
der vergleichenden Biologie, ein Beitrag zur organismischen Staatsauffassung<br />
im Anschluss an E. G. Kolbenheyer“, den Doktortitel. Da Kolbenheyer<br />
als Vertreter des Biologismus im nationalsozialistischen Kulturleben eine Rolle<br />
gespielt hatte, musste Erich Mühle sich während der Entnazifizierung einigen<br />
ihm unliebsamen Fragen stellen, obwohl er es im Unterschied zu den meisten an<br />
der <strong>Universität</strong> tätigen Agrarwissenschaftlern abgelehnt hatte, Mitglied der NS-<br />
DAP zu werden. Ebenfalls 1937 begann er eine Tätigkeit als wissenschaftlicher<br />
Hilfsarbeiter in der Abteilung Gartenbau und danach am Institut für Pflanzenbau<br />
und Pflanzenzüchtung. Im darauf folgenden Jahr erhielt er auf Vorschlag des<br />
Direktors des Instituts, Josef Knoll, einen Lehrauftrag für Pflanzenschutz, 1939<br />
eine planmäßige Assistentenstelle. Von 1940 bis 1944 war Erich Mühle u. a. an<br />
Versuchen zur Bekämpfung von Gräserschädlingen beteiligt. Die Krankheiten<br />
und Schädlinge der Futterpflanzen, aber auch der Arznei-, Gewürz- und Duftpflanzen,<br />
über die noch wenige Erkenntnisse vorlagen, sollten dann lebenslang<br />
seine Hauptforschungsgebiete werden. Er steht damit einerseits in der von Wilhelm<br />
Strecker und Friedrich Falke begründeten bedeutenden Grünlandtradition<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong>, stellte sich andererseits aber auch anderen neuen Herausforderungen.<br />
1942 zog ihn die Wehrmacht zum Kriegsdienst ein, entließ ihn<br />
aber zu seinem Glück aus gesundheitlichen Gründen wieder. Im Februar 1945<br />
wäre er aber in dem bei einem Fliegerangriff zerstörten Gebäude Johannisallee<br />
19 fast ums Leben gekommen, als er und einige andere der wenigen verbliebenen<br />
Mitarbeiter verschüttet wurden.<br />
Als einer der wenigen Agrarwissenschaftler setzte er nach dem Krieg seine Tätigkeit<br />
an der <strong>Universität</strong> fort. Trotz schwieriger materieller Bedingungen habilitierte<br />
er sich 1951 mit der Arbeit „Die Krankheiten und Schädlinge angebauter<br />
Futtergräser, Erhebungen, Beobachtungen und Untersuchungen über ihr<br />
Auftreten, ihre Biologie und Bekämpfung unter gleichzeitiger Auswertung des<br />
wichtigsten Schrifttums“. Sein Habilitationskolloquium stand unter dem Thema<br />
„Die Probleme des Kartoffelabbaus“ und seine öffentliche Lehrprobe widmete<br />
sich den „Viruskrankheiten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen“, womit er Breite<br />
und Tiefe in seinem Fachgebiet bewies. Am 1. April 1951 wurde er deshalb<br />
zum Professor mit Lehrauftrag für Phythopathologie berufen, am 1. Oktober<br />
1951 zum Professor mit vollem Lehrauftrag und am 1. September 1952 in Anerkennung<br />
seiner Verdienste in Lehre und Forschung sowie beim Wiederaufbau<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Leipzig</strong> zum Professor mit Lehrstuhl und zum Direktor des aus<br />
der Abteilung Pflanzenschutz hervorgegangenen Instituts für Phytopathologie,<br />
das in der Schönbachstraße 10 nahe dem Völkerschlachtdenkmal seinen Platz<br />
erhielt. Von 1951 bis 1958 leitete er neben seiner Tätigkeit in <strong>Leipzig</strong> die Abtei-<br />
54